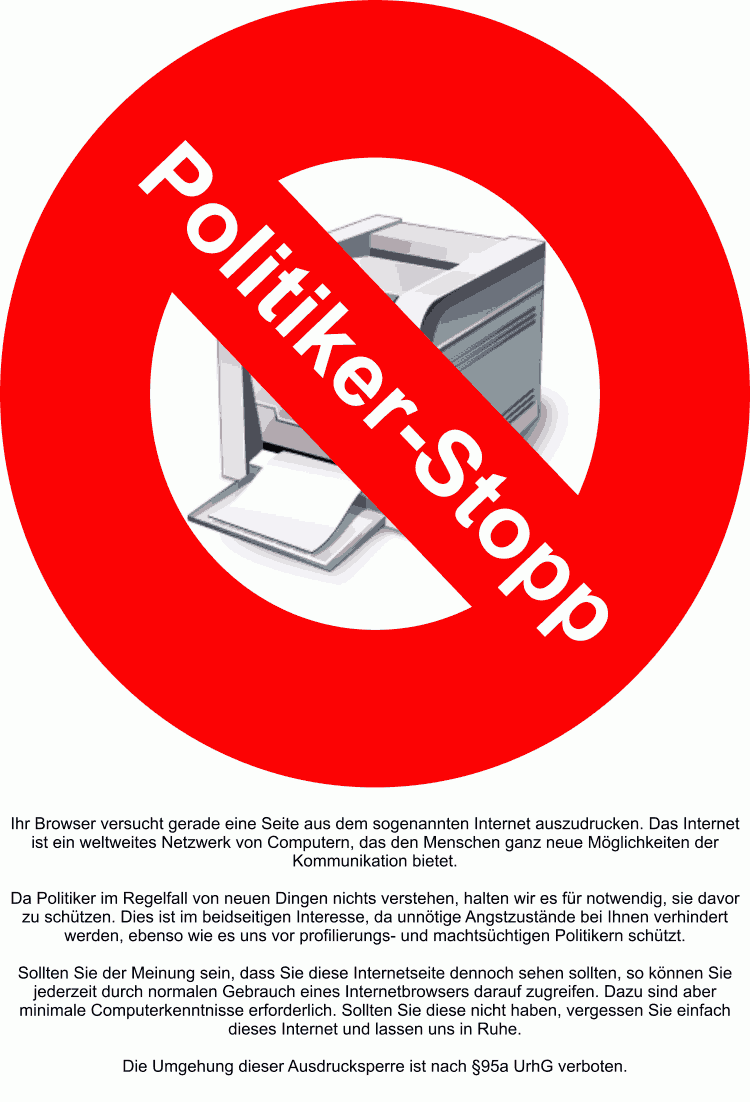- Karl Albrecht Schachtschneider
- Familie
- Familienpolitik
- Familienrecht
 I. Einführung
I. Einführung
Art. 6 Abs. 1 GG stellt Ehe und Familie unter „den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 sagt in Art. 16 Nr. 3: „Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.“
In Teil 1 Nr. 16 der europäischen Sozialcharta von 1961 steht: „Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft hat das Recht auf angemessenen sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz, der ihre volle Entfaltung zu sichern vermag.“
In Art. 10 Nr. 1 S. 1 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte erkennen die Vertragsstaaten an, dass „die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesellschaft größtmöglichen Schutz und Beistand genießen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Gründung und solange sie für die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich“ ist.[1]
In der Grundrechtecharta der Europäischen Union, die durch den Vertrag von Lissabon verbindlich werden soll, heißt es in Art. 33 nur noch: „Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.“
Aber unser Staat weiß nicht mehr, wie er die Familie schützen soll, schon weil er nicht mehr weiß, was eine Familie ist. Bereits Martin Wolff hat 1928 geklagt, die Geschichte der Familie sei die „Geschichte ihrer Zersetzung“.[2]
Längst
- [1] Vgl. i.d.S. noch BVerfGE 6, 55 (71); 24, 119 (149 f.); LECHELER, H.: Schutz von Ehe und Familie, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI, Müller, Heidelberg 1989, § 133, Rdn. 26
- [2] Familienrecht, Elwert, Marburg, 6. Bearbeitung 1928, S. 2; dazu BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, 2. Aufl., Mohr, Tübingen 1965, S. 89 ff.; auch HÖSLE, V.: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert, Beck, München 1997, S. 853 („Kernfamilie“, „in schwerer Krise“); abwägend MÜNCH, E. M. v.: Ehe und Familie, in: E. BENDA/W. MAIHOFER/H. J. VOGEL (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl., De Gruyter, Berlin 1994, S. 293 ff., § 9, Rdn. 2
Seite 2
werden Ehe und Familie entgegen dem grundgesetzlichen Text nicht mehr als Einheit erfasst.[3]
Zweck der Ehe ist nicht mehr die Familie, wie es bis heute die christlichen Kirchen lehren.[4]
Die Ehe ist zur bloßen Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau abgesunken, auf Lebenszeit oder auch nur auf Zeit.[5]
Die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ist ihr fast gleichgestellt.[6]
Die zivile Ehe ist weder Sakrament noch heiliger Stand[7], sondern in der Republik „verrechtlichte“ „bürgerlich-rechtliche“ Institution[8], hat aber im säkularen Staat den herausgehobenen Status verloren.[9]
Das Scheidungsrecht schützt Ehe und Familie nicht, sondern behindert allenfalls die Scheidung und belastet die Ehe und auch die Familie mit wirtschaftlichen Risiken, die von der Eheschließung abzuraten nahelegen.[10]
Die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ist auch ohne
- [3] Etwa GRÖSCHNER, R.: in: DREIER, H. (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, Artikel 1 – 19, 2. Aufl., Mohr, Tübingen 2004, Art. 6, Rdn. 39 ff., 67 ff., insb. Rdn. 69 ff., 76 ff., im Sinne der „Entkoppelung von Ehe und Familie“; anders BVerfGE 6, 55 (71 f.); 11, 64 (69); 76, 1 (51); dazu selbst vorsichtig CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, VVDStRL 45 (1987), De Gruyter, Berlin 1987, S. 21; richtig jedoch ZEIDLER, W.: Ehe und Familie, in: E. BENDA/W. MAIHOFER/H. J. VOGEL (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, De Gruyter, Berlin 1983, S. 555 ff., 592; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 42 ff., 59 ff.; SCHWAB, D.: Ausgeträumt, in: Glanzlichter der Wissenschaft. Ein Almanach, hrsg. v. Deutschen Hochschulverband, Lucius & Lucius, Stuttgart 2007, S. 155 f.
- [4] Dazu SCHWAB, D.: Familie, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. O. BRUNNER/W. CONZE/R. KOSELLECK, Bd. 2, E-G, Klett-Cotta, Stuttgart 1975, S. 253 ff.
- [5] Kritisch LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 25, 91 ff. (gegen nichteheliche Lebensgemeinschaft als eheähnlich), Rdn. 22 f. (für die grundsätzliche Unauflöslichkeit); vgl. auch BVerfGE 9, 20 (32, 34 f.); 36, 146 (165)
- [6] Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften (LPartG) vom 16.02.2001 (BGBL. I, S. 266, in Kraft ab 01.08.2001, novelliert durch Gesetz vom 15.12.2004 (BGBl. I, S. 3396); zur Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 1 GG BVerfGE 105, 313 (342 ff.); dazu SCHWAB, D.: Familienrecht, 15. Aufl., Beck, München 2007, Rdn. 870 ff., S. 427 ff.; ders.: Ausgeträumt, S. 155; befürwortend HÖSLE, V.: Moral und Politik, S. 856; MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 8
- [7] CIC, Lib. IV, Tit. VII, De matrimonio, Can. 1055, § 1; zum Stand der Ehe bei Luther W. ELERT, Das christliche Ethos. Grundlinie der lutherischen Ethik, 2. Aufl., hrsg. v. E. KINDER, Furche, Hamburg, 1961, S. 110 ff., 123 ff.; vgl. BÖHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 119 ff. (122); SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 21, S. 15 f.; GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 11.
- [8] BVerfGE 31, 58 (82 f.); 53, 224 (245); ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 561
- [9] Vgl. ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 558 ff. („Erschütterungen und Veränderungen“), S. 574 ff., 593 f.
- [10] Ganz so ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 587 (Familienrecht „abschreckende Wirkung“ für Eheschließung), S. 600
Seite 3
Ehe rechtens, ja sie wird vom Gesetzgeber mehr und mehr wie die eheliche Lebensgemeinschaft behandelt.[11]
Der Familienbegriff ist reduziert.
Ein Kind macht die Familie aus, sei es dessen Gemeinschaft mit der Mutter und/oder mit dem Vater, sei es die mit einer oder zwei Frauen oder die mit einem oder zwei Männern mit dem Kind anderer[12], obwohl auch das Bundesverfassungsgericht im Familiennachzugsbeschluss noch an die Einheit von Ehe und Familie erinnert hat, nämlich:
„Die Ehe ist die rechtliche Form umfassender Bindung zwischen Mann und Frau; sie ist alleinige Grundlage einer vollständigen Familiengemeinschaft und als solche Voraussetzung für die bestmögliche körperliche, geistige und seelische Entwicklung von Kindern“[13], so relativiert doch die Formulierung den Familienbegriff bereits.[14]
Der Familienbegriff folgt in der Praxis dem Schutzbedürfnis des Kindes.[15]
Von den Eltern ist der Familienbegriff gelöst, obwohl nach Art. 6 Abs. 2 GG „Pflege und Erziehung der Kinder […] das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ ist.
Eltern dieses Grundrechtes sind die leiblichen Eltern, Mutter und Vater, ob unverheiratet oder verheiratet[16], aber diese können ihr
- [11] Vgl. SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 29, S. 18 f., Rdn. 833 ff., S. 409 ff.; ders.: Ausgeträumt, S. 156; kritisch CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 16 ff.; STEIGER, H., daselbst zum nämlichen Thema, S. 61 f., 78 f.; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 91 ff.; vgl. BVerfGE 56, 363 (383 ff.); 67, 186 (195); weitgehend befürwortend ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 562, 574 ff., 581; MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 10 ff.
- [12] Vgl. BVerfGE 18, 97 (105 f.); 24, 119 (135); 25, 167 (195 f.); 45, 104 (123); 56, 363 (382); 79, 256 (267); ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 584; STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 62 ff., 80 ff.; MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 13 ff., 16; CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 21 ff.; GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 67 ff. (71 f., 77 f.); a.A. LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 29 ff. (32), 42 ff. (46)
- [13] BVerfGE 76, 1 (51); deutlicher noch BVerfGE 25, 167 (196): „… die Ehe die einzige legitime Form umfassender Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau ist und die gesunde körperliche und seelische Entwicklung des Kindes grundsätzlich das Geborgensein in der nur in der Ehe verwirklichten vollständigen Familiengemeinschaft mit Vater und Mutter voraussetzt“; vgl. i.d.S. BVerfGE 22, 163 (173); 24, 119 (149)
- [14] I.d.S. GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 71
- [15] Vgl. BVerfGE 10, 59 (76); 56, 363 (381 ff.); 59, 360 (376); 60, 79 (88: „… das Kindeswohl muss die oberste Richtschnur der elterlichen Pflege und Erziehung sein“); in der Sache ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 584; MÜNCH, E. M. v., HVerfR, § 9, Rdn. 13 f., 16; GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 71 f., 78; SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 155 ff.
- [16] BVerfGE 84, 168 (179); 92, 158 (177 f.); 107, 150 (169, 173); anders noch BVerfGE 24, 119 (135), eheliche Eltern und Mutter außerehelich geborener Kinder; BVerfGE 56, 363 (384); 79, 203 (210)
Seite 4
Grundrecht vielfach nicht oder nicht richtig ausüben; denn als Eltern müssen sie zusammenleben.
Alle anderen Formen elterlicher Sorge sind nur Notmaßnahmen.
Eltern mit Kindern sind die Familie, die das Grundgesetz schützen will[17], wie sich unzweideutig aus der Schutzvorschrift des Art. 6 Abs. 5 GG zugunsten unehelicher Kinder ergibt.[18]
Der Staat hat die Familie nicht zu schützen vermocht.
Er hat die Ordnung der Ehe und Familie mehr und mehr dem hedonistischen Zeitgeist angepasst und damit deren Verfall beschleunigt.
Fraglos sind die Eingriffe der Menschen in das natürliche Leben kausal für den Niedergang von Ehe und Familie, vor allem die Verhütung und der Abbruch von Schwangerschaften.[19]
Die veränderten Lebensverhältnisse sind von einem Wechsel des Menschenbildes begleitet.
Nicht mehr die Familie ist die „natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft“, sondern der einzelne Mensch, nicht das Glück der Familie leitet die Politik, sondern das des Einzelnen.
Ich handle von der Familie in der deutschen Zivilisation, in der islamischen Kultur hat die Familie einen gänzlich anderen Stand.
Durch die Entwertung des Familienprinzips hat die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine andere Konnotation erfahren.
Niemand, der der Aufklärung verpflichtet ist, mag diese Gleichberechtigung in Frage stellen, aber wenn die Familie die Politik orientiert, führt das zu einem anderen Gleichberechtigungsrecht,
- [17] MANGOLDT, H. v./KLEIN, F.: Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Vahlen, Berlin/Frankfurt 1955/57, Art. 6 Anm. III 5, S. 267; LECHELER, H.: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – das Beispiel von Ehe und Familie, DVBl. 1986, 905 (907); ders.: HStR, § 133, Rdn. 29 ff., 42 ff., 59; vgl. i.d.S. auch CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 21 f.; ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 559; zu Art. 119 WRV h. L., vgl. WIERUSZOWSKI, A.: Art. 119, Ehe, Familie, Mutterschaft, in: NIPPERDEY, H.C. (Hrsg.) Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, 2. Bd., Hobbing, Berlin 1930, S. 72 ff., 90 ff.
- [18] So CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 23; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 32, 46; anders MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 23 ff.; vgl. BVerfGE 25, 167 (195 ff.); zu Art. 6 Abs. 5 GG BOEHMER, G., Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 104 ff.
- [19] ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 588 ff.
Seite 5
als wenn den Einzelnen gleiche Rechte geschaffen werden sollen.[20]
Grund und Ziel der Gleichbehandlungspolitik ist die Ausrichtung von Mann und Frau auf die Erwerbstätigkeit.
Ehe und Familie werden hintangestellt.
Kinder behindern die Erwerbsarbeit und führen meist in karge Lebensverhältnisse.[21]
Folglich werden sie vermieden, allenfalls ein Kind, höchstens zwei Kinder werden hingenommen, weil sie die Erwerbsarbeit weiter zulassen.
Das mehr oder weniger christliche Europa leidet unter Kinderarmut, die große Niederlage unserer kulturlosen Zivilisation, die ohne die Zuwanderung noch größer wäre.
In dieser Lage vermag der Staat seiner Aufgabe, Ehe und Familie zu schützen, nicht mehr gerecht zu werden.
Er kann das Schutzgut nicht einmal tragfähig definieren.
Der Wert von Ehe und Familie ist dem Staat im dekadenten Gemeinwesen verloren gegangen, nicht allen Familien.
Die Kinder stören den Tanz um das goldene Kalb.
Die Fördermaßnahmen des Staates sind hilflos und setzen falsche Anreize.
Sie zerstören langfristig die Voraussetzungen des freiheitlichen Gemeinwesens.
Familien anderer Kulturen, vor allem anderer Religiosität, die oft nicht einmal die Sprache des Familienstandortes sprechen, haben keine Integrationschance und genügen nicht der für ein freiheitliches Gemeinwesen erforderlichen Homogenität.[22]
Die Religionsfreiheit rechtfertigt keine Politik des langfristigen staatlichen Religionswechsels des Volkes.
Aber Familien fremder Kultur von der Förderung auszuschließen, verbietet das Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes.
Bevölkerungspolitik des Staates ist im freiheitlichen Gemeinwesen ohnehin fragwürdig.
Keinesfalls darf Familienpolitik zu einer Bevölkerungspolitik werden, welche
- [20] Zur Entwicklung des Individualismus in der Familie schon im 18. Jahrhundert SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 278 ff., zur Gegenbewegung der Romantik im 19. Jahrhundert S. 284 ff.
- [21] ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 597 ff.
- [22] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Res publica res populi. Grundlegung einer Allgemeinen Republiklehre. Ein Beitrag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, Duncker & Humblot, Berlin 1994, S. 1177 ff.
Seite 6
das Gemeinwesen auflöst und dessen Grundwerte in Gefahr bringt, die einer weltanschaulichen oder religiös homogenen Grundlage bedürfen.
Wenn der Staat die Erwerbstätigkeit der Mütter, etwa durch Krippenplätze, fördert, macht er Politik jedenfalls gegen große Familien, die von dem Einsatz der Mütter oder auch der Väter in der Familie abhängen.[23]
Im Übrigen gefährdet er das Wohl der Kinder.
Wenn der Staat die Mütter, die bei den Kindern bleiben, finanziell fördert, geht diese Förderung bevölkerungspolitisch in die falsche Richtung.
Die sozial- und steuerpolitischen Maßnahmen setzen fragwürdige ökonomische Anreize, welche die weltanschauliche Not der Ehe- und Familienpolitik nicht zu überwinden vermögen.[24]
 II. Scheidung
II. Scheidung
Als Kern der Familie ist die Ehe eine Lebensgemeinschaft auf Lebenszeit (§ 1353 Abs. 1 S. 1 BGB).
Die Ehe hat unterschiedliche Phasen, ihre Gründung, meist in Liebe, die Elternzeit, die einige Jahrzehnte dauern kann und meist zugleich die wesentliche Zeit der Berufstätigkeit ist, und die Zeit des (so genannten) besten Alters, in der die Ehegatten oft Großeltern sind, und schließlich die Zeit des hohen Alters und des Sterbens.
Immer ist es der Familie dienlich, dass Mann und Frau zusammenleben, insbesondere als Eltern und Großeltern.
Am Anfang des gemeinsamen Lebens ist der Zusammenhalt von selbst groß, am Ende gibt es aus menschlichen und auch aus wirtschaftlichen Gründen keine gleichwertige Alternative.
Demgemäß ist die Ehe in allen Zeiten und fast in allen Völkern eine lebenslange Lebensgemeinschaft gewesen.[25]
Aber die Lebenszeitigkeit der Ehe hat der Gesetzgeber nicht geschützt.
Sie ist zwar nach § 1353 Abs. 1 S. 1 BGB noch immer Begriffsmerkmal der Ehe, aber Absatz 2 dieser
- [23] I.d.S. ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 601 ff.
- [24] Dazu ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 601 ff., 605 ff.
- [25] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 254 („Urerfahrung“)
Seite 7
Vorschrift stellt sie praktisch in das Belieben der Ehegatten.[26]
Wenn „ein Ehegatte sich weigert, dem Verlangen des anderen Ehegatten nach Herstellung der Gemeinschaft Folge zu leisten, weil sich das Verlangen als Missbrauch seines Rechts darstellt oder weil die Ehe gescheitert ist“, kann der andere Ehegatte zwar auf Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft klagen, aber abgesehen davon, dass ein Herstellungsurteil nicht vollstreckbar ist (§ 888 Abs. 2 ZPO), ist eine solche Klage geradezu ehewidrig.
Erzwingen lässt sich die eheliche Gemeinschaft nicht.
Das könnte leicht zur Vergewaltigung in der Ehe führen (§ 177 StGB).
Mehr als ein Drittel der Ehen scheitern im Sinne des § 1353 Abs. 2 BGB, aber viele Ehen werden gar nicht erst geschlossen, weil die Paare zwar ein gemeinsames Leben führen, aber nicht in einer Ehe.
Mehr und mehr werden die nichtehelichen oder eheähnlichen Lebensgemeinschaften vom Staat so behandelt, als seien sie Ehen, im Elternrecht, im Unterhaltsrecht, im Sozialrecht.[27]
Eine Ehe ist nach § 1565 Abs. 1 S. 2 BGB „gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wieder herstellen.“
Nach § 1566 Abs. 1 BGB „wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustimmt.“
Nach § 1566 Abs. 2 BGB „wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben.“
Die Ehegatten leben nach § 1567 Abs. 1 S. 1 BGB getrennt, „wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft
- [26] Kritisch auch LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 76; SCHWAB., D: Ausgeträumt, S. 156; nicht unkritisch ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 585 f.; vgl. auch BVerfGE 53, 257 (300 ff., 308 ff., 312 f.); 55, 134 (141 ff.); 57, 361 (387 ff.)
- [27] Vgl. SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 830 ff., S. 408 ff.; ders.: Ausgeträumt, S. 155; dafür ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 574 ff.
Seite 8
ablehnt.“
Diese Ablehnung bedarf keiner vorwerfbaren oder gar nachweisbaren Gründe.
Auch innerhalb der ehelichen Wohnung kann die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten getrennt sein (S. 2).
Ausnahmsweise soll nach der Härteklausel des § 1568 „die Ehe nicht geschieden werden, obwohl sie gescheitert ist, wenn und solange die Aufrechterhaltung der Ehe im Interesse der aus der Ehe hervorgegangen minderjährigen Kinder aus besonderen Gründen ausnahmsweise notwendig ist, oder wenn und solange die Scheidung für den Antragsgegner, der sie ablehnt, aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine so schwere Härte bedeuten würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe auch unter Berücksichtigung der Belange des Antragstellers ausnahmsweise geboten erscheint.“
Das Zerrüttungsprinzip stellt auf einen Sachverhalt an sich nachprüfbarer materieller Zerrüttung ab.[28]
Der (1938!) eingeführte Scheidungsgrund „tiefgreifender, unheilbarer Zerrüttung der ehelichen Verhältnisse“, wenn die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben und die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten war, die zudem u.U. den Widerspruch des an der Zerrüttung nicht schuldigen Ehegatten zuließ (§ 48 EheG), wurde von den Scheidungsrichtern geprüft.[29]
Wegen der „unwiderlegbaren Vermutungen“ des § 1566 BGB aber kommt es in der Praxis allein auf den Ehewillen der Ehegatten an, ob die Ehe gescheitert ist oder nicht.
Ein Ehegatte, der die häusliche Gemeinschaft erkennbar nicht herstellen will, trennt die Ehe, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft (zur Überzeugung des Familiengerichts) ablehnt.[30]
Der Wille zur Ehe ist maßgeblich, nicht die Pflicht zur Ehe, entgegen § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB, der die Ehegatten einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet.
Der Gesetzgeber hat dieser Pflicht durch das Scheidungsrecht die Verbindlichkeit genommen.
Sie bleibt eine sittliche Pflicht, die aber hängt von der Moralität der Ehegatten, von
- [28] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 302, S. 147
- [29] DIEDERICHSEN, U.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 34. Aufl., Beck, München, 1975, § 48 EheG, Rdn. 3b, 4, auch § 43, Rdn 5 f.
- [30] BGH NJW 1978, 1810; SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 302. S. 147; ders.: Ausgeträumt, S. 156
Seite 9
deren gutem Willen zur Ehe ab.
Dafür bedarf es keines Gesetzes.[31]
„Die Ehe ist wesentlich ein sittliches Verhältnis“ (HEGEL)[32], „eine sittliche Lebensgemeinschaft“ (Bundesverfassungsgericht 1959).[33]
Gesetzliche Pflichten müssen in irgendeiner Weise erzwingbar sein.
Keinesfalls dürfen mit der Missachtung der Pflichten Vorteile verbunden werden, wie durch das Scheidungsfolgenrecht.[34]
Jedenfalls müssen Gesetze binden, also Verbindlichkeit haben.
Das hat die Ehepflicht nach den widersprüchlichen Gesetzesvorschriften gerade nicht, weil die Pflicht zur Ehe durch den Willen zur Ehe überlagert wird.
Dieser Wille ist nicht Freiheit als praktischer Vernunft[35], sondern Willkür, bestimmt durch Neigungen.
Ehen werden nicht geschieden, weil sie zerrüttet sind, sondern weil ein Ehegatte oder beide Ehegatten nicht mehr in der Gemeinschaft leben, die Ehe nicht mehr leben wollen, aus welchen Gründen auch immer.
Sicher hat eine Scheidung Gründe, meist sind Dritte ins Leben eines Ehegatten getreten.
Diese Gründe aber werden verfahrensrechtlich und damit auch sachrechtlich nicht relevant.
Sie werden im Scheidungsverfahren meist gar nicht vorgetragen, allenfalls im Sorgerechts- und Unterhaltsstreit, um dem anderen Elternteil die elterliche Sorge streitig zu machen (§ 1666 BGB) bzw. um den Unterhaltsanspruch abzuwenden (§ 1579 BGB).
Die „unheilbare Zerrüttung“ als Scheidungsgrund ist Fiktion.
Keine Regelung hat dem Bestand der Ehe mehr geschadet als diese Relativierung der im Begriff der Ehe genannten Lebenszeitigkeit der Lebensgemeinschaft
- [31] Zur wesentlich sittlichen Konzeption der Ehe und Familie im 19. Jahrhundert SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 284 ff., 290 ff.
- [32] Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrissen, 1821, Fischer Bücherei, Frankfurt am Main 1968, § 161, S. 177
- [33] BVerfGE 10, 59, Leitsatz; diese Definition hat das Gericht nicht aufrechterhalten; vgl. SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 160
- [34] Kritisch ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 585 f.; auch BVerfGE 53, 257 (300 ff., 308 ff., 312 ff.); 57, 361 (387 ff.); 57, 335 (314 ff.)
- [35] Zum freiheitlichen Willensbegriff SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, Duncker & Humblot, Berlin 2007, S. 86, 322; KANT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785/1786, ed. Weischedel, Bd. 6, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, S. 41; ders.: Kritik der praktischen Vernunft, 1788, daselbst, S. 140 ff. (142)
Seite 10
durch das Vermutungsprinzip des Scheidungsrechts.[36]
Die Lebenszeitigkeit ist das Wesen der Ehe als einer Gemeinschaft für das ganze Leben.[37]
Die Regelung des § 1566 BGB lässt nicht einmal einer Ehe auf Zeit für einen bestimmten Lebensabschnitt die Verbindlichkeit, sondern hebt die Verbindlichkeit für die ganze Zeit der Ehe auf.
Schlimmer noch: Die Eheschließung begründet keine wirkliche primäre Rechtspflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft, sondern lediglich sekundäre Rechtspflichten während der Ehe und insbesondere nach der Ehe.
Dieses Eherecht folgt einer romantischen Eheideologie[38] und macht den Bestand der Ehe von der Liebe unter den Ehegatten abhängig, also von deren ehelicher Moralität. „Liebe ist Ehe“.
Ehe bedeutet das Einswerden von Mann und Frau in der Liebe.[39]
Diese Liebe ist nicht das Rechtsprinzip.[40]
Das Scheidungsfolgenrecht, insbesondere die Unterhaltspflichten nach §§ 1569 ff. BGB, lässt angesichts dessen, dass die Ehe seit der Scheidungsreform 1976 (EheRG vom 14. Juni 1976, BGBl. 1421) keine rechtlich wirklich bindende Lebensgemeinschaft mehr ist, geraten sein, eine Lebensgemeinschaft nicht mehr als Ehe zu führen, sondern eben als nichteheliche/eheähnliche Lebensgemeinschaft, die offen auf den bloßen Willen gestellt ist, dass die Partner zusammenleben wollen, und die sekundären Rechtsfolgen der Eheschließung weitgehend vermeidet.[41]
Demgemäß werden ein großer Teil der Lebensgemeinschaften nicht
- [36] Kritisch auch LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 84, aber differenzierend (wegen der Wirklichkeit); MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 9
- [37] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 98, S. 52; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 22 f.; vgl. GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 51 f. (kritisch zum „Unauflöslichkeitsdogma“); CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 26 f.; vgl. BVerfGE 10, 59 (66) grundsätzlich „unauflöslich“; BVerfGE 31, 58 (82); 53, 224 (245) grundsätzlich „unauflösbar“; BVerfGE 62, 323 (330)
- [38] Dazu SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 284 ff.
- [39] Vgl. SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 286, der auf Friedrich Schlegels Roman „Lucinde“ (Berlin 1799) hinweist; kritisch HEGEL, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrissen, § 161, S. 177
- [40] Zum Rechtsprinzip SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S., 110 ff., 254, 481, 509 ff., 636; richtig zum „prekären“ Verhältnis von Liebe und Ehe HÖSLE, V.: Moral und Politik, S. 853
- [41] Ganz so ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 587
Seite 11
mehr als Ehe eingegangen und wenn denn doch, meist weil Kinder geboren wurden, erst nach langer nichtehelicher Lebensgemeinschaft.
Die Folge ist, dass mehr als ein Drittel der deutschen Kinder unehelich geboren werden.
Diese Entwicklung widerspricht dem Familienprinzip des Grundgesetzes diametral.
Allerdings gilt das für ein gutes Drittel der in Deutschland aufwachsenden Kinder nicht, weil sie aus Migrantenfamilien stammen[42], die vergleichsweise intakte Familienverhältnisse haben.
Ehe und Familie, welche das Grundgesetz unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung gestellt hat, war eine andere Einrichtung.
Die Ehe war rechtlich bindender Stand, grundsätzlich nur aus bestimmtem Verschulden (Ehebruch, tiefe Zerrüttung durch schwere Eheverfehlung oder ehrloses oder unsittliches Verhalten) scheidbar (§§ 42, 43 EheG, eine Ausnahme Zerrüttung nach § 48 EheG) und im Übrigen ein (die Frauen weitgehend entmündigender) Güterstand der Verwaltung und Nutznießung des Mannes (Verwaltungsgemeinschaft, § 1362 bis § 1424 BGB a.F.).[43]
Freilich ist auch dieses Eherecht gesellschaftlich unterlaufen worden, etwa durch einverständliche Scheidungen mittels verabredeter Schuldzugeständnisse nach Absprachen über die elterliche Gewalt (elterliche Sorge) über die Kinder und den Unterhalt u.a..[44]
Niemand wird bestreiten, dass das Schuldprinzip des alten Eherechts zu Ungerechtigkeiten, meist zu Lasten der Frauen, geführt hat, die bei schuldiger Scheidung fast alle Rechte aus der Ehe und Familie eingebüßt haben (vgl. § 1671 Abs. 3 S. 2 BGB a.F., elterliche Gewalt; § 58 EheG, Unterhalt).[45]
Der Mann konnte die Frau aus der Familie verweisen, allerdings auch umgekehrt die Frau den Mann, falls der eine Ehegatte dem anderen die Schuld an der Scheidung nachweisen konnte.
- [42] Ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren haben so genannten Migrationshintergrund, Nürnberger Zeitung vom 12.3.2008, S. 6
- [43] Dazu BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 159 ff., insb. S. 164 f.
- [44] Vgl. BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 130; ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 585 („Unaufrichtigkeit“, „forensische Unredlichkeit“)
- [45] DIEDERICHSEN, U.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 42. Aufl., Beck, München, 1983, Einführung vor § 1564, Rdn. 2
Seite 12
Das Zerrüttungsprinzip war an sich eine richtige Antwort auf die ehe- und familienrechtliche Entwicklung der Praxis[46], einer Fehlentwicklung in der Gesellschaft.
Aber das Zerrüttungsprinzip ist nicht wirklich materialisiert worden.
Die unwiderlegbaren Vermutungen des § 1566 BGB nach formalisierten Tatbeständen der Trennungsdauer, dass die Ehe gescheitert sei, hat die Zerrüttung zur Fiktion gemacht.[47]
Man wollte das harte Schuldprinzip, das vielfach ins Unrecht geführt hat, beseitigen und hat dadurch die Ehe und die Familie als Institution ruiniert, also an die Stelle von vielfachem Unrecht allgemeine Rechtlosigkeit gesetzt.
Die Zerrüttung einer Ehe an materialen Kriterien messen zu wollen, ist nicht leicht, fast unmöglich, jedenfalls im gerichtlichen Verfahren.
Auch die in § 621 a ZPO, § 12 FGO vorgeschriebene Amtsmaxime, also die Ermittlung der Tatsachen durch das Gericht anstelle des streitfallbestimmenden Vortrags der Parteien (Parteimaxime), hilft nicht.
Die Verhältnisse einer Ehe sind von außen kaum sichtbar und kaum verstehbar.
Der Richter ist in der Sache doch von dem Vortrag der Parteien, also der Ehegatten, abhängig.
Dieser Vortrag wird von den (obligatorischen) Scheidungsanwälten zusätzlich verfälscht.
Die Schwierigkeit, die Zerrüttung zu objektivieren, hat zu den gesetzlichen Vermutungsregeln geführt, ja geradezu gezwungen, der Sache nach aber den Bestand der Ehe in das Belieben der Ehegatten, jedes für sich, gestellt.
Es wäre auch mehr als problematisch, dass Richter die Ehegatten, welche die eheliche Lebensgemeinschaft nicht fortsetzen wollen, zum Fortbestand der Ehe verpflichten.
Es gibt auch so gut wie keine Klagen auf Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft.[48]
Nur
- [46] ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 585 („unvermeidlich und überfällig“)
- [47] Kritisch SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, Aussprache, VVDStRL 45 (1987), De Gruyter, Berlin 1987, S. 136 f.; auch LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 84, unkritisch MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 9
- [48] BRUDERMÜLLER. G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 64. Aufl., Beck, München 2005, Einführung vor § 1353, Rdn. 12, § 1353, Rdn. 16 („in der Praxis obsolet geworden“)
Seite 13
hat dieses Dilemma die Einrichtung Ehe als lebenslange Lebensgemeinschaft aufgehoben.
Das Tatbestandsproblem lässt zwei Lösungen zu: entweder keine Scheidung trotz Zerrüttung der Ehe oder eben Scheidung unabhängig von einer Zerrüttung derselben, also nur nach der Willkür der Ehegatten, d.h. im Regelfall nach der Willkür eines Ehegatten, heute meist der Frauen, die hinreichende Gründe für das Scheidungsverlangen haben mögen, auf die es aber nicht ankommt.
Im ersten Fall würde der Gesetzgeber, d.h. der Staat, den Ehegatten zumuten, sich um einen weiteren gemeinsamen Lebensweg zu mühen.
Meines Erachtens ist das in den meisten Fällen zumutbar, schon im Interesse der Kinder, nicht nur in den Fällen der Härteklausel des § 1568 BGB.
Im zweiten Fall wird Dritten die Last (der Lust eines Ehegatten auf einen anderen Lebensweg) zugemutet, nämlich den Kindern, dem Ehegatten, der die Ehe fortsetzen will, dem Gemeinwesen, das die Kosten der durch die Scheidung entstehenden Armutsfälle zu tragen hat.
Selten finden geschiedene Ehegatten das Glück nach der Scheidung, ob sie nun allein bleiben, in nichtehelicher Gemeinschaft leben oder erneut eine Ehe eingehen.
Das Glück oder bescheidener: die Zufriedenheit, ist auch eine Frage der Lebenskunst der Menschen, die mit der jeweiligen Ehe wenig zu tun hat, gegebenenfalls auch eine Frage des Glaubens.
Es ist nicht rechtens, Willkürakte, wie die Scheidung nach §§ 1564 ff. BGB, zum Schaden Dritter auszuüben, aber auch nicht rechtens, derartige Willkürakte zu ermöglichen.
Das verbietet das Sittengesetz, der kategorische Imperativ.[49]
Durch die Ehe wird eine neue Welt geschaffen, in der viele Menschen leben, Kinder, Eltern, Schwiegereltern u.a., jedenfalls eingebunden sind.
Diese Welt durch Scheidung willkürlich zu zerstören ist Unrecht.
Dafür muss es einen triftigen, also wichtigen Grund geben.
„Aber die Gesetzgebungen müssen diese
- [49] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 67 ff., 353 f.
Seite 14
Möglichkeit (sc.: der Auflösung der Ehe) aufs Höchste erschweren, auch das Recht der Sittlichkeit gegen das Belieben aufrechterhalten“, postuliert Hegel.[50]
Ein solcher Grund wäre die unheilbare Zerrüttung, welche das gemeinsame Leben unzumutbar macht, durchaus.
„Unheilbare Zerrüttung“ dürfen aber nicht nur leere Worte sein, vielmehr müssen diese zu Rechtsbegriffen werden, die nicht den Regelfall der Eheentwicklung, sondern deren Ausnahmefall regieren, wie alle Härtefallbegriffe, wie überhaupt der Begriff der Zerrüttung, erst recht der der unheilbaren Zerrüttung, aber auch der Begriff der Unzumutbarkeit bezwecken.
Folglich müssen Tatbestandmerkmale entwickelt werden, welche die Zerrüttung einer Ehe materiell derart beschreiben, dass sie ohne Willkür judizierbar sind.
Nur ein materialer Zerrüttungsbegriff vermag Ehe und Familie zu schützen, also deren Bestand einer leichtfertigen Lebensgestaltung durch die Ehegatten vorzuziehen.
Zu derartigen Begriffen sind wir augenscheinlich kulturell nicht (mehr) in der Lage.
Der Gesetzgeber hatte und hat nicht die Kraft, dem Verfall der gesellschaftstragenden Einrichtung Ehe und Familie zu widerstehen.
Die formalen Vermutungskriterien des Scheidungsrechts sind das Gegenteil eines besonderen Schutzes von Ehe und Familie durch die staatliche Ordnung, also verfassungswidrig.
Das Bundesverfassungsgericht hat freilich im Jahr 1980 in BVerfG 57, 224 ff. das neue Scheidungsrecht, also das Zerrüttungsprinzip, nicht als Verletzung des Grundgesetzes zu erkennen vermocht.
In der Entscheidung hat das Gericht die Kinder mit keinem Wort erwähnt.
Das Schuldprinzip, so fragwürdig wie es gewesen sein mag, hat Ehe und Familie weitaus besser geschützt als das Zerrüttungsprinzip und wurde damit dem Grundgesetz mehr gerecht.
Die gesetzliche Regelung selbst, das Zerrüttungsprinzip, zerrüttet die Ehen und zerstört die Familien, weil man sich jederzeit scheiden lassen, jederzeit ein neues
- [50] Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrissen, § 163, S. 179; dazu SCHWAB, D.: Familie, Geschichtliche Grundbegriffe, S. 292
Seite 15
Glück versuchen kann.
Das Angebot des Gesetzgebers wird angenommen, massenhaft.
Es gibt keine hinreichenden Anreize (Druck) zur Pflichterfüllung.
Hinzu kommt, dass einer der Ehegatten sich durch die Scheidung Vorteile verschaffen kann, jedenfalls Vorteile zu erringen meint, und seien diese Vorteile nichts anderes als Nachteile des irgendwann einmal geliebten, jetzt gehassten Partners.
Eine solche Schädigung ist manch einem Ehegatten Genugtuung.
Es widerspricht dem Rechtsprinzip, dass jemand ohne besondere Gründe zum Schaden anderer handeln darf, nämlich dem Grundsatz des neminem laedere.[51]
Äußere Freiheit ist nach Kant die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür.[52]
Das Scheidungsrecht aber ermöglicht, dass ausgerechnet die Ehe, deren größtmöglicher Bestandsschutz ihrem Wesen entspricht, willkürlich zu Lasten Dritter beendet werden kann, sei der Dritte der Ehepartner, seien es die Kinder oder sei es das Gemeinwesen.
Die Scheidungsreform von 1976 hat wie keine andere familienpolitische Maßnahme Ehe und Familie zu einem Rechtsproblem gemacht.
Vor dem Eherechtsreformgesetz war die Ehe nicht nur als solche eine rechtlich gefestigte Lebensgemeinschaft, sondern wurde zudem durch vielerlei Sekundärrecht stabilisiert.
So war eine nichteheliche Lebensgemeinschaft nicht möglich. Die Vermietung einer Wohnung an ein unverheiratetes Paar war Kuppelei.
Das hat die strittige und streitbare Praxis nicht nur nach § 180 StGB bestraft[53], sondern auch das Mietverhältnis wurde nach § 134 BGB wegen Gesetzwidrigkeit und nach der Strafrechtsreform von 1969 nach § 138 BGB wegen Sittenwidrigkeit als nichtig
- [51] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 353 f.
- [52] Metaphysik der Sitten, 1797/1798, ed. Weischedel, Bd. 7, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, S. 345; dazu SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 67 ff.
- [53] Vgl. SCHWARZ, O./DREHER, E.: Strafgesetzbuch, Kommentar, 25. Aufl., Beck, München 1963, § 180, Anm. 1 A a, b, B, b, 3 B, S. 532 ff.; SCHÖNKE, A./SCHRÖDER, H.: Strafgesetzbuch, Kommentar, 15. Aufl., Beck, München 1970, § 180, Rdn. 4, 10; etwa AG Emden, JR 1976, 60 f.; SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 155
Seite 16
behandelt.[54]
An solchen rechtlich zweifelhaften Mietverhältnissen hatte kein Vermieter Interesse.
Der nichteheliche Verkehr in der elterlichen Wohnung war nicht nur Unzucht, sondern für die Eltern, die die Wohnung den möglicherweise sogar Verlobten überlassen hatten, als schwere Kuppelei nach § 181 StGB strafbar und zwar bis zu fünf Jahren, mindestens ein Jahr Zuchthaus.[55]
Da lief nichts ohne Ehe, außer auf der Parkbank.
Die Frage ist: Wollen wir Ehen und wollen wir Kinder? Wenn ja, müssen wir die Scheidung so erschweren, dass sie zur Ausnahme wird.
Das ist eine Zumutung für die Ehegatten, aber eine sittliche Zumutung, also rechtens.
Wenn wir Ehen wollen, müssen wir eheähnliche Lebensgemeinschaften unterbinden, also die Alleinstellung der Ehe wiederherstellen.
Das ist jahrhundertelang gelungen, aber es wäre Überwindung von Dekadenz, Wiedergewinnung der Selbstachtung des deutschen Volkes, religiös oder weltanschaulich.
Das verlangt eine alle Lebensbereiche ändernde Politik, die uns freilich von innen und außen schwer gemacht wird.
Die große Familie, welche die Ehe stabilisiert, haben wir nicht und werden wir allenfalls gewinnen, wenn sich eine Religion oder Weltanschauung in Deutschland durchgesetzt haben wird, die die Kraft hat, die Sittlichkeit der Familie zu verteidigen.
Das Christentum scheint diese Kraft verloren zu haben.
Aber schützen können wir unsere Zivilisation nur, wenn wir die kulturelle Dekadenz überwinden und sittliche Prinzipien durchsetzen, gegen die Libertinage.
Der Staat der Parteien ist dazu nicht in der Lage.[56]
- [54] AG Emden, Urteil vom 11.02.1975 (!), JR 1976, 60 f.; strittig, ablehnend W. LINDACHER, Anmerkung, JR 1976, 61 ff.; kritisch W. HEFERMEHL, in: H. SOERGEL/W. SIEBERT, Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 1, Allgemeiner Teil, Kohlhammer, Stuttgart u.a., 1978, § 138, Rdn. 178
- [55] BGHSt (Großer Senat) 6, 46 (53 f.); SCHWARZ, O./DREHER, E.: Strafgesetzbuch, § 181, 3 b
- [56] Kritik des Parteienstaates SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Res publica res populi, S. 1045 ff.; ders.: der republikanische Parteienstaat, 2000, in: ders., Freiheit – Recht – Staat, hrsg. v. SIEBOLD, D. I./EMMERICH-FRITSCHE, A., Duncker & Humblot, Berlin 2005, S. 213 ff.
Seite 17
 III. Unterhalt
III. Unterhalt
1. Der Unterhalt der Kinder und der betreuenden Mutter (gegebenenfalls auch des Vaters), aber auch der bedürftigen Ehegatten ist durchaus notwendig, aber die Unterhaltsregelungen des Gesetzes schaden dem Familienprinzip.
Während der Ehe sind nach § 1360 BGB „die Ehegatten einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten“ (S. 1), „Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts“ (S. 3).
Nach § 1360a BGB „umfasst der angemessene Unterhalt der Familie alles, was nach den Verhältnissen der Ehegatten erforderlich ist, um die Kosten des Haushalts zu bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten und den Lebensbedarf der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder zu befriedigen“.
Solange die eheliche Lebensgemeinschaft intakt ist, machen die Unterhaltspflichten keine besonderen Schwierigkeiten.
Die Ehegatten richten ihr Eheleben so ein, wie sie es für richtig halten und sind dazu auch berechtigt.[57]
„Leben die Ehegatten getrennt, so kann“ nach § 1361 Abs. 1 BGB „ein Ehegatte von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen“.
Nach Absatz 2 dieser Vorschrift „kann der nicht erwerbstätige Ehegatte nur dann darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu verdienen, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, insbesondere wegen einer früheren Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehegatten erwartet werden kann“.
Diese Regelung kann, wenn der Zusammenhalt der Ehegatten nicht mehr besteht, bereits erhebliche
- [57] STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 63 f.; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 62 f., 65, 77; BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1353, Rdn. 5; vgl. BVerfGE 10, 59 (84 f.); 48, 327 (338); 66, 84 (94); 68, 250 (268)
Seite 18
Schwierigkeiten bereiten, auf die ich nicht näher eingehen will, um mich den Grundsatzfragen widmen zu können.
In den weiteren Vorschriften für das Getrenntleben der Ehegatten bestimmt § 1361d BGB, dass ein getrennt lebender Ehegatte verlangen kann, „dass ihm der andere die Ehewohnung oder einen Teil zur alleinigen Benutzung überlässt, soweit dies auch unter Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden.
Eine unbillige Härte kann auch gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist“.
Diese Vorschrift zeigt bereits den Schaden, den das Getrenntleben für die Familie bedeutet, zumal Absatz 3 Satz 2 dieser Vorschrift auch noch einen Anspruch auf Vergütung für die Nutzung vorsieht, soweit dies der Billigkeit entspricht.
Die Kinder haben einen Unterhaltsanspruch aus § 1603 BGB gegen die Eltern, weil sie in gerader Linie mit diesen verwandt sind.
Der Unterhaltsanspruch hängt nach § 1602 BGB davon ab, dass der Unterhaltsberechtigte außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, die minderjährigen unverheirateten Kinder von ihren Eltern insoweit, „als die Einkünfte aus Vermögen und der Ertrag der Arbeit zum Unterhalt nicht ausreicht“ (S. 2).
Diese Kinder müssen ihr Vermögen als solches nicht in Anspruch nehmen.
Nicht unterhaltspflichtig ist nach § 1603 Abs. 1 BGB, „wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren“.
„Befinden sich Eltern in dieser Lage, so sind sie ihren minderjährigen unverheirateten Kindern gegenüber verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden.
Diesen Kindern stehen „volljährige unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gleich, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden“.
In einem solchen Notfall müssen die Kinder auch den Stamm ihres Vermögens für ihren Unterhalt in Anspruch nehmen (Abs. 2).
Nach § 1610 BGB bestimmt sich das Maß des zu gewährenden
Seite 19
Unterhalts nach der Lebensstellung des Bedürftigen („angemessener Unterhalt“, Abs. 1) und umfasst der Unterhalt „den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf, bei einer der Erziehung bedürftigen Person auch die Kosten der Erziehung“ (Abs. 2).
Die Besonderheiten der elterlichen Unterhaltspflicht führe ich wiederum nicht aus.
Besonders wichtig sind die Unterhaltsansprüche der geschiedenen Ehegatten.
Sie sind in § 1569 bis § 1586b BGB geregelt.
Das Gesetz kennt sieben Unterhaltstatbestände nach der Scheidung, nämlich den Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB, den Unterhalt wegen Alters nach § 1571 BGB und wegen Krankheit oder Gebrechen nach § 1572 BGB, subsidiär den Erwerbslosenunterhalt nach § 1573 Abs. 1 BGB, den Aufstockungsunterhalt nach § 1573 Abs. 2 BGB, den Billigkeitsunterhalt nach § 1576 BGB und als Sonderfall den Ausbildungsunterhalt nach § 1575 BGB. Die Tatbestandsmerkmale dieser Anspruchsgrundlagen tragen nicht zur Klärung der Grundsatzfragen bei.
Besonders erwähnt werden muss aber der Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB, wonach ein geschiedener Ehegatte von dem anderen Unterhalt verlangen kann, „solange und soweit von ihm wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinsamen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann“.
Diese Vorschrift begründet vor allem einen Anspruch der geschiedenen Mütter, weil sie regelmäßig die Pflege oder Erziehung der Kinder übernehmen oder übertragen bekommen.
Nach der Rechtsprechung ist eine Erwerbstätigkeit des Elternteils, der die gemeinschaftlichen Kinder betreut, bis zum 8. Lebensjahr in der Regel nicht zumutbar, zwischen dem 8. und dem 11. Lebensjahr kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an, insbesondere auf die Gesundheit von Kind und Mutter, aber auch auf die Beschäftigungschancen der Mutter.
Zwischen dem 11. und dem 15. Lebensjahr wird dem betreuenden Elternteil regelmäßig eine Teilzeitbeschäftigung zugemutet, die aber keine Halbtagsbeschäftigung sein muss.
Mit Vollendung des 15. Lebensjahres des Kindes erwartet die Rechtsprechung von der Mutter (oder eben
Seite 20
dem Vater) volle Erwerbstätigkeit.
Wenn die Kinderzahl höher ist, wird Erwerbstätigkeit nur in geringerem Umfang zugemutet, etwa bei zwei Kindern eine Teilzeittätigkeit erst ab dem 14. oder 15. Lebensjahr des älteren Kindes, bei drei Kindern unter 14 Jahren wird keine Erwerbstätigkeit verlangt.[58]
Diese Kriterien sollen nicht schematisch gehandhabt werden, sondern je nach Einzelfall differenziert, geben der Praxis aber verbindliche Orientierung.
Nach § 1574 Abs. 1 BGB muss der geschiedene Ehegatte nur eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben.
„Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie den ehelichen Lebensverhältnissen entspricht“ (Abs. 2).
Nach Absatz 3 dieser Vorschrift wird aber auch von dem geschiedenen Ehegatten, soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist, verlangt, dass er sich ausbilden, fortbilden oder umschulen lässt, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.
Auf Einzelheiten kann ich wiederum nicht eingehen.
Wenn die Unterhaltsverpflichtung wegen kurzer Dauer der Ehe (Nr. 1), wegen eines Verbrechens oder schwerem vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder dessen nahe Angehörige (Nr. 2), wegen mutwilliger Herbeiführung der Bedürftigkeit (Nr. 3), weil sich der Berechtigte mutwillig über die Vermögensinteressen des Verpflichteten hinweggesetzt hat (Nr. 4), er seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat (Nr. 5), wegen offensichtlich schwerwiegendem Fehlverhaltens gegen den Verpflichteten (Nr. 6) oder aus sonstigen ebenso schwer wiegenden Gründen (Nr. 7) grob unbillig ist, entfällt sie nach § 1579 BGB ganz oder zum Teil.[59]
Diese Härteklausel ist Grund vieler Streitigkeiten.[60]
Die Unterhaltspflicht hängt nach § 1581 BGB von der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen unter
- [58] BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1370, Rdn. 8 ff.
- [59] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 375 ff., S. 187 f.; BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1579, Rdn. 2 ff.
- [60] LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 85 („großer Kampfplatz des Unterhaltsrechts“ D. Schwab)
Seite 21
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen ab.
Wenn er der Unterhaltpflicht ohne Gefährdung des eigenen angemessenen Unterhalts nicht nachkommen kann, so braucht er nur insoweit Unterhalt zu leisten, als es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Erwerbs- und Vermögensverhältnisse des geschiedenen Ehegatten der Billigkeit entspricht.[61]
Den Stamm des Vermögens braucht er nur zu verwerten, wenn das nicht unwirtschaftlich oder unbillig ist.
Wenn die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten begrenzt ist, geht der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten dem des neuen Ehegatten grundsätzlich vor (§ 1582 BGB).
Allerdings gehen die minderjährigen unverheirateten Kinder anderen Kindern und unterhaltsberechtigten Verwandten vor, nicht aber dem Ehegatten (§ 1609 Abs. 2 S. 1 BGB).
Auch nach der Scheidung geht der Anspruch des unterhaltsberechtigten Ehegatten dem Anspruch anderer Kinder und übriger Verwandten vor (S. 2).
Das Maß des Unterhalts bestimmt sich gemäß § 1578 Abs. 1 S. 1 BGB nach den ehelichen Lebensverhältnissen.
Diese Klausel hat eine umfangreiche Rechtsprechung hervorgebracht.
Maßgeblich sind die Einkommensverhältnisse der Ehegatten während der ehelichen Lebensgemeinschaft.
Praktiziert wird grundsätzlich der Halbteilungsgrundsatz, d.h. dass beide geschiedenen Ehegatten die Hälfte des verteilungsfähigen Einkommens beanspruchen können.[62]
Die Berechnungsgrundlagen haben viele Aspekte.
Gegebenenfalls wird auch Einkommen fingiert.[63]
Für die familienrechtlichen Grundsatzfragen kommt es darauf nicht an.
Einen Unterhaltsanspruch hat auch eine Mutter wegen der Pflege oder Erziehung eines Kindes aus einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, wenn von ihr
- [61] Dazu BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1581, Rdn. 2 ff.; SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 363 ff., S. 180 ff.
- [62] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 358 ff., S. 175 ff., Rdn. 364, S. 181 f.; BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1578, Rdn. 2
- [63] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 359, S. 178 f.; BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1578, Rdn. 4, 6
Seite 22
eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann (§ 1615 l Abs. 2 S. 2 BGB).
Dieser Unterhaltsanspruch beginnt frühestens vier Monate vor der Geburt und endet drei Jahre nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen (S. 3).
Nichteheliche Kinder haben den gleichen Unterhaltsanspruch wie eheliche Kinder (§ 1615a BGB).
Die Problematik und die Fragwürdigkeiten des Versorgungsausgleichs nach §§ 1576 ff. BGB will ich hier nicht ansprechen.[64]
2. Trotz der Vielfalt der Regelungen, welche den geschiedenen Ehegatten in verschiedenen Lebenslagen einen Unterhaltsanspruch gegen den früheren Ehegatten geben, insbesondere auch im Falle der Erwerbslosigkeit (§ 1573 BGB), orientiert sich das nacheheliche Unterhaltsrecht zunehmend am Kindeswohl.[65]
Bisher galten §§ 1609 Abs. 2, 1603 Abs. 2 BGB, wonach der Ehegatte, ob geschieden oder nicht, den minderjährigen unverheirateten Kindern (§ 1609 Abs. 2 BGB) und den volljährigen unverheirateten Kindern bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, solange sie im Haushalt der Eltern leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden (§ 1603 Abs. 2 BGB), gleichstellt ist.[66]
§ 1609 BGB in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Unterhalts (UnterhaltsänderungsG) vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I, 3189), das seit dem 1. Januar 2008 in Kraft ist, misst allen unterhaltsberechtigten minderjährigen und unverheirateten Kindern und den Kindern im Sinne des § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB unabhängig davon, ob sie aus einer Ehe, insbesondere aus einer ersten oder zweiten
- [64] Dazu SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 392 ff., S. 195 ff.
- [65] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 367, S. 182; vgl. BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1582, Rdn. 9; weitere Hinweise in Fn. 68
- [66] Dazu BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1609, Rdn. 6 ff., § 1603, Rdn. 56
Seite 23
Ehe, hervorgegangen sind oder aus einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder auch ohne eine solche, einen ersten Rang zu und den geschiedenen Ehegatten oder früheren Lebenspartnern nur einen zweiten oder auch nur dritten (nicht betreuende Elternteile) Rang und begrenzt zudem deren Betreuungsunterhaltsanspruch grundsätzlich auf drei Jahre (§ 1570 BGB n.F.), so dass diese gezwungen sein werden, schnellstmöglich eine Erwerbsarbeit aufzunehmen.
Zur „Gleichbehandlung der Kinder ungeachtet ihres Familienstandes“ verpflichtet Art. 6 Abs. 5 GG den Gesetzgeber:
„Den nichtehelichen Kindern sind durch die positiven Regelungen die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern“ (BVerfG Beschluss des Ersten Senats vom 28. Februar 2007).[67]
Der neue Grundsatz des nachehelichen Unterhaltsrechts ist nach § 1569 BGB n.F. der der „Eigenverantwortung“: „Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen.
Ist er dazu außerstande, hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden Vorschriften.“
Nach § 1574 Abs. 1 BGB n.F. „obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, eine Erwerbstätigkeit auszuüben“.
Kindeswohl ist ein schönes Wort, aber es wird durch die Unterhaltsansprüche nicht erreicht, gerade weil das Wohl der Familie vernachlässigt wird, der Familie als Einheit.
Nur das Familienwohl verwirklicht das Kindeswohl.
Dazu gehört das Wohl der Mutter, aber auch das Wohl des Vaters, nämlich das Wohl der Eltern und der Kinder.
Die Kinder gehören zu den Eltern und die Eltern zu den Kindern.
Nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist demgemäß „die Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuförderst ihnen obliegende Pflicht“.
Auch deswegen muss der Schutz der Familie und damit auch der Ehe Vorrang vor den unterhaltsrechtlichen Notmaßnahmen haben, also der Bestand von Ehe und Familie bestmöglich geschützt werden.
Die massenhaften
- [67] BVerfGE 118, 45 (52 ff.); kritisch SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 158 f.
Seite 24
Scheidungen darf ein Gemeinwesen, das die Verantwortung für Ehe und Familie an sich gezogen hat, nicht hinnehmen.
Aber der Staat hat deren Schutz aufgegeben, schlimmer noch, er schadet dem Familienprinzip durch sein Scheidungsfolgenrecht, wie die Entwicklung der Familien in unserem Lande erweist, nämlich Kinderlosigkeit zum einen und Unehelichkeit der Kinder zum anderen.
Das Leitprinzip Kindeswohl[68] verdeckt die Familienferne des Gesetzes oder schärfer, die Familienfeindlichkeit der Familienpolitik, das spätestens seit dem Eherechtsreformgesetz von 1976 Familienunrecht ist.
Es gibt keinerlei Ansätze in der Politik, dieses Unrecht zu beheben.
Der Grund ist die an dem Männerbild ausgerichtete Frauenpolitik, also ein missverstandenes Gleichheitspostulat.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt, sagt das Grundgesetz in Art. 3 Abs. 2 S. 1.
Dieser Satz ist unerschütterlich und geradezu ein menschheitliches Grundprinzip.
Er besagt aber nicht, dass Männer und Frauen in jeder Weise gleich oder gar unterschiedslos sind.
Insbesondere sagt er nicht, dass der Staat eine Politik machen muss, die es Frauen nicht nur ermöglicht, sondern diese geradezu zwingt, ein Leben zu führen wie Männer, jedenfalls nicht, wenn die Frauen Mütter sind.
In Wirklichkeit ist der höchste Wert der ökonomistischen Familienpolitik keineswegs das Wohl des Kindes, sondern die Erwerbsarbeit der Menschen, nicht die Familie, sondern die Arbeitskraft von Männern und Frauen, das Humankapital, die Ausbeutbarkeit der Menschen.
Dabei haben die Lebensentwürfe der Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, in der Politik, in den Medien, in der Unterhaltung, auch in der Verwaltung und Rechtsprechung, aber auch in den Schulen und Hochschulen, eine (zweifelhafte) Vorbildfunktion.
Frauen haben immer gearbeitet, ja viele geschuftet, gerade in den wenig begüterten Familien, oft härter als die Männer, in den Haushalten nämlich. Nach wie vor machen Haushalt und Familie viel Arbeit.
Große Familien sind kleine
- [68] BVerfGE 10, 59 (76, 83 ff.); 39, 169 (183); 48, 327 (338); 56, 363 (381 ff.); 59, 360 (376); 60, 79 (88, 94); 107, 150 (170 ff.); ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 584; GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 101 u.ö.; richtig ZACHER, H.F.: HStR, § 134, Rdn. 91, 95; SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 157
Seite 25
Unternehmen, meist von den Müttern gemanagt.
Das Gemeinwesen braucht die Arbeit, die Tatkraft der Frauen in der Wirtschaft und in den Haushalten.
Viele Frauen wollen der Doppelbelastung entgehen oder diese gar nicht erst auf sich nehmen.[69]
Die meisten suchen einen Mittelweg zwischen Erwerbsarbeit und Familie, indem sie sich auf ein Kind, allenfalls zwei Kinder, beschränken, so dass sie noch eine Chance zur Erwerbsarbeit haben, verstärkt nach der Elternzeit.
Der Gesetzgeber misst im Übrigen nach wie vor der Hausarbeit der Frau oder auch des Mannes den gleichen wirtschaftlichen Wert zu wie der Erwerbsarbeit (§ 1360 S. 2. BGB).[70]
Das ist die berechtigte Grundlage des Zugewinnausgleichsprinzips nach Beendigung einer Ehe oder auch nur des gesetzlichen Güterstandes (§§ 1372 ff. BGB).
Aspekte der Kritik sind:
Erstens: Der Ersatz des Schutzes der Familie, von deren Bestand, durch nacheheliche Unterhaltsansprüche ermöglicht die Scheidung der Ehe und die Auflösung der Familie.
Zwar entstehen meist dürftige, aber doch lebbare Verhältnisse, zumal die größte Not durch Sozialhilfe des Staates abgewendet wird.
Zweitens: Das Elend einer gescheiterten Familie ist für Männer und Frauen so groß, dass viele Menschen das Risiko einer Ehe und Familie nicht eingehen und gar nicht erst heiraten.
Wenn sie aber doch diesen Schritt machen, dann vermeiden sie tunlichst den Schritt zur Familie, nämlich Kinder zu bekommen.[71]
Das Risiko ist zu groß, weil beide Ehegatten die Ehe jederzeit ohne Grund beenden können.
Die Unterhaltsansprüche der Kinder und Ehegatten, meist der Mütter, reichen keinesfalls, um ein Leben wie in der Familie führen zu können, weil auch der Unterhaltspflichtige, meist der Vater, sich noch unterhalten können
- [69] Richtig ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 597 ff. („Familienfrau“ – „Packesel des Sozialstaates“); SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 158 f., 160
- [70] SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 203, S. 103 f.; BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1360, Rdn. 9; HÖSLE, V.: Moral und Politik, S. 857
- [71] Ganz so ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 587, 600
Seite 26
muss und durch die Trennung der Familie die Lebenshaltungskosten steigen.
Der Mindestbehalt des unterhaltspflichtigen Ehegatten, der im Mangelfall am Existenzminimum orientiert wird, beträgt knapp 1.000 €[72], so dass angesichts der meist mäßigen Einkommen nicht genügend bleibt, um die verschiedenen Ansprüche zu erfüllen.
Hinreichender Wohlstand einer Familie setzt meist voraus, dass nicht nur der Mann, sondern auch die Frau erwerbstätig ist.
Die geplante Rangliste der Unterhaltsansprüche wird die Ablehnung der Familien weiter verstärken.
Drittens: Die Männer vermeiden zunehmend von vornherein die Unterhaltspflichten nach einer Ehe, indem sie eine Ehe erst gar nicht eingehen.
Eine Frau können sie auch anders haben, sogar in rechtlich geordneter Lebensgemeinschaft.
Die Hälfte der Männer wollen nicht Väter sein, eine naturwidrige Lebensweise.
Ein wesentlicher Grund ist neben dem Hedonismus das Ehe- und Familienrecht, das Versagen der Rechtsordnung.
Viertens: Die Unterhaltsansprüche genügen nicht nur dem Umfang, sondern auch in ihrer Dauer nicht den Lebensbedürfnissen.
Der unterhaltsberechtigte Ehegatte, meisten die Frau und Mutter, soll schnellstmöglich zur Erwerbsarbeit gedrängt werden.
Dafür werden jetzt neben den Kindertagesstätten auch Krippenplätze zur Verfügung gestellt, weitgehend kostenlos, aber meines Erachtens zum Schaden der Kinder und Familien.
Das entlastet die Väter und entbindet vor allem den Staat, der den wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der alleinerziehenden Mütter leistet, von seinen Pflichten.
Wenn die Zeit der Unterhaltsberechtigung der betreuenden Mütter auf drei Jahre beschränkt wird, wird sich die staatliche Zerstörung der Familien, seien diese ehelich oder nicht ehelich, beschleunigen.
Kinder brauchen die Familie solange, bis sie erwachsen sind, meist noch viel länger.
- [72] Dazu BRUDERMÜLLER, G.: in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 1581, Rdn. 16 ff., 23 (840 Euro, Düsseldorfer Tabelle für Erwerbstätige Unterhaltspflichtige)
Seite 27
Einen Ausweg sucht das Gemeinwesen, immer streng der Ideologie des Zeitgeistes verpflichtet, also politisch korrekt, in der ganztägigen Unterbringung der Kinder in öffentlichen Einrichtungen.
Das soll möglichst für alle Kinder in der Kinderkrippe anfangen, in der Kindertagesstätte weitergehen und über die Ganztagsschule bis zum Vollstudium führen.
Die Eltern sollen durch ihre Kinder nicht von der Erwerbsarbeit abgelenkt werden, vor allem auch die Frauen nicht mehr.
Diese Entfremdung der Kinder von ihren Eltern und der Familie ist mit Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG schlechterdings unvereinbar, aber auch mit Art. 6 Abs. 1 GG, dem Ehe- und Familienprinzip, nicht.
Für manche Unterschichtverhältnisse mag die Verstaatlichung der Kindheit und Jugend besser sein als das häusliche und familiäre Elend, jedenfalls aus der Sicht der Gutmenschen.
Das ist aber nicht für die Familien mit Migrationshintergrund richtig, die meist völlig intakt sind. Deren Kinder sollen eingedeutscht werden, ein vergebliches Bemühen.
Sie werden, jedenfalls, wenn muslimisch, muslimisch bleiben, zumal die Muslime bald die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen bilden werden.
Es gibt im Übrigen kein Recht des Staates, diesen Kindern die deutsche Sprache aufzudrängen.
Das verletzt das Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, zu dem das Menschenrecht gehört, die Muttersprache zu sprechen, wo auch immer man lebe.[73]
Ob diese Familien nach Deutschland gehören, ist eine Frage, auf die ich im Rahmen der Familienproblematik nicht eingehen muss.
Keinesfalls hat der Staat das Recht, die Erziehung der Kinder und Jugendlichen weitestgehend den Eltern aus der Hand zu nehmen, auch nicht durch finanzielle Anreize und schon gar nicht durch wirtschaftlichen Druck auf die Mütter, am Erwerbsleben teilzunehmen, den er durch die familienfeindliche Politik erzeugt.
- [73] Art. 10 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom 01.02.1995 (BGBl. 1997 II, S. 1407); auch Art. 8 Abs. 1 EMRK (Achtung des Privat- und Familienlebens), Art. 14 EMRK (Verbot der Diskriminierung wegen der Sprache und der nationalen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit)
Seite 28
Insgesamt schadet die Familienpolitik den Familien.
Das Gemeinwesen hat seine Fähigkeit verloren, eine staatliche Familienpolitik zu machen, die dem Grundgesetz und auch den Menschenrechten entspricht.
Der Staat muss die Familien sich selbst, den Bürgern, überlassen.
Diese werden eine Vielfalt von Familienformen verwirklichen.
Einige werden sich durchsetzen, hoffentlich solche, die die Sittlichkeit der Familie wiederbeleben, nicht die liberalistischen, sondern die republikanischen, bürgerlichen, die dem Gemeinwohl, der res publica, am besten gerecht werden, die allen ein gutes Leben in Freiheit und auch Wohlstand ermöglichen.
 IV. Verrechtlichung der Familie
IV. Verrechtlichung der Familie
Familie und staatliches Gesetz passen schlecht zueinander.[74]
Das verbindende Prinzip der Familie ist (jedenfalls seit der Romantik in Deutschland) die Liebe, das des Staates die Gesetzlichkeit.
Dem Staat ist es nie gelungen, ein Familienrecht zu schaffen, das der Familie gerecht wird.
Die Familie ist eine condicio humana, seit Menschengedenken eine Einrichtung, ohne die der Mensch nicht leben konnte und im Allgemeinen nicht kann.[75]
Einzelne Menschen können es jetzt, weil ihnen das Gemeinwesen durch seinen Staat die Möglichkeit verschafft.
Der Staat ist menschheitsgeschichtlich eine junge Einrichtung, die sich aber mehr und mehr des Menschen in jeder Lebenslage bemächtigt hat.
Es kennzeichnet den totalen Staat, dass er die Menschen auch in den Familien reglementiert und das Familienprinzip zurückdrängt.
Im Altertum waren Familie und, wenn man so will, Staat getrennt.[76]
In Griechenland war das Haus der Ort der Familie, der οικος und die οικονομια mit
- [74] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 284 ff., 290 ff., zur Romantik; ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 592
- [75] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 254
- [76] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 259
Seite 29
der Familie, beherrscht von dem δεσποτης.[77]
Die Familie war der ganze Hausstand, also Frau, Kinder, Sklaven, in Rom noch ganz ähnlich der domus, beherrscht vom dominus, dem pater familias, wiederum mit dem ganzen Hausstand einschließlich der Sklaven.
Die πολις der Griechen hatte in dem οικος keine Gewalt und konnte allenfalls durch νομοι einwirken.
Nicht anders war es in der res publica Roms.
Der pater familias hatte die Hausgewalt, die potestas, wie in den griechischen Städten der δεσποτης die δεσποτεια.
Im Hause bestand keineswegs Rechtlosigkeit.
Vielmehr war das Haus ein Ort der Sittlichkeit, aber eben nicht der Gesetzlichkeit.
Im Hause gab es keine Rechtsverhältnisse, sondern (dreierlei: Mann – Frau, Vater – Kinder, Herr – Sklaven[78]) Familienverhältnisse.
In Rom bestimmten die boni mores die häuslichen Verhältnisse, in den griechischen Städten der εθος.
Um häusliche Verhältnisse, also die Familienverhältnisse, konnten nicht vor einem Gericht, einem δικαστηριον oder einem praetor gestritten werden.
Haus und Familie waren somit autonom und gerade dadurch Grundlage des Gemeinwesens, der πολις oder der res publica.[79]
Nur der δεσποτης oder der pater familias war Mitglied der πολις oder der res publica.[80]
Die Einheit von Haus und Familie und die Trennung derselben vom Staat hat sich lange gehalten.[81]
Hegel sieht in der Rechtsphilosophie (§§ 169 ff.) die Familie als (selbständige) Person, durch „den Mann als ihr Haupt vertreten“ (§ 171), die der Staat größtmöglich gegen die Willkür der Auflösung schützen
- [77] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 259 f.
- [78] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 258 ff.
- [79] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 262 f.
- [80] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 262 f.; dazu HENKE, W.: Recht und Staat. Grundlagen der Jurisprudenz, Mohr, Tübingen 1988, S. 319 ff. (320, 239 f.); GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 9 f.
- [81] Vgl. BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 90 f., 103, auch S. 131 ff.; STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 68 f.; ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 558 ff.; SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 254 ff., 271 ff.; BRUNNER, O.: Das „Ganze Haus“ und die alteuropäische „Ökonomik“, in: ders. (Hrsg.), Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. 2. Aufl., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968, S. 193 ff.; ders.: Vom „gesamten Haus“ zur Familie, in: H. ROSENBAUM (Hrsg.), Familie und Gesellschaftsstruktur, Fischer, Frankfurt 1974, S. 48 ff.
Seite 30
müsse (§ 163).[82]
Noch unter dem Grundgesetz gab es die väterliche Gewalt in der Familie, die an dem Gleichberechtigungsprinzip des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 2) gescheitert ist, in letzter Konsequenz erst 1961.[83]
Aber der Gesetzgeber ist zu weit gegangen.
Er hat den Gewaltbegriff (elterliche Gewalt) durch den der (elterlichen) Sorge ersetzt[84] und damit der Familie die Ordnungsmacht abgesprochen.
Familiengewalt ist wie Staatsgewalt die Möglichkeit und Befugnis, Ordnung zu schaffen, zu befrieden[85], nicht etwa wesentlich die zur vis, dem körperlichen Zwang, sondern die potestas.[86]
Die Ordnungsmacht beansprucht jetzt auch in der Familie allein der Staat.
Damit hat der Staat das wohl wichtigste Element der Gewaltenteilung beseitigt und sich vollends zum totalen Staat entwickelt.
Die meisten Abgeordneten werden nicht geahnt haben, dass sie die Verfassung in ihren Grundlagen verändern würden, als sie die elterliche Gewalt abgeschafft haben.
Schließlich hat es auch das Bundesverfassungsgericht nicht bemerkt. Der gutmenschliche Zeitgeist war durchgreifender als das Staatsrecht.
Aber auch in den Lehrbüchern des Familienrechts findet man nichts zu dieser Problematik, geschweige denn in den Lehrbüchern zum Staatsrecht.
Erst in jüngster Zeit hat der Staat die Familienverhältnisse völlig verrechtlicht und dadurch die Menschen auch in der Familie, sei es als Untertanen, sei es als Bürger,
- [82] Dazu SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 288 ff.; STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 69
- [83] Gleichberechtigungsgesetz (GleichberG) 18.06.1957 (BGBl. I, 609); Familienrechtsänderungsgesetz vom 11.08.1961 (BGBl. I, 1221); BVerfGE 3, 225 (239 ff.); 10, 59 (72 ff.); BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 131, 150 ff.; CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: VVDStRL 45 (1987), S. 13
- [84] Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge (SorgeRG) vom 18.07.1979 (BGBl. I, 1061); dazu MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 16, den Gewaltbegriff verkennend.
- [85] Dazu SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 257, 264 (zu M. Luther), 270, 283 f., 289 (Familie ist Staat), S. 290 (Hegels Familie ist natürliches sittliches Gemeinwesen), S. 293 f., 298 (zum Vierten Stand, der kein Haus hat); ders.: Ausgeträumt, S. 160
- [86] Vgl. GÜNTHER, H.: Herrschaft, in: O. BRUNNER/W. CONZE/R. KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Klett-Cotta, Stuttgart 1982, S. 39 ff.; MEIER, Ch.: Macht, Gewalt, daselbst, S. 820 f.; RIEDEL, M.: Der Begriff der „Bürgerlichen Gesellschaft“ und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs, 1962/1969, in: E.-W. Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt 1976, S. 86 f.; STERNBERGER, D.: Der alte Streit um den Ursprung der Herrschaft, 1977, in: ders., Herrschaft und Vereinbarung, Schriften Bd. III, 1980, S. 9 ff., auch in: ders., Herrschaft und Vereinbarung, Suhrkamp, München 1986, S. 26 ff.; SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 100 ff., 108 ff., 130 f.
Seite 31
jedenfalls als Rechtssubjekte, vereinzelt.[87]
Er hat damit, wenn man so will, entgegen dem Subsidiaritätsprinzip die stärkste intermediäre Gewalt entmachtet und der Familie ihren eigentlichen Status genommen, den körperschaftlichen Status.[88]
Das Subsidiaritätsprinzip gibt der kleinen Ordnungsmacht den Vorrang vor der größeren und sichert dadurch die Republikanität des Gemeinwesens, nämlich die Freiheit durch die vielfältige Teilung, aber auch die größtmögliche Nähe der Ordnungsgewalt zur Ordnungsaufgabe.[89]
Die res publica ist ohne die domus mit der potestas des pater familias nicht vorstellbar.
Die Verrechtlichung ist Verstaatlichung der Familienverhältnisse und Auflösung der Familie in einzelne Rechtsverhältnisse.
Das hat, wie wir heute einsehen müssen, der Familie und dem Staat mehr geschadet als genützt.
Es war diese eigenständige, wesentlich private, vom Staat unabhängige Familie, welche das Grundgesetz unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung gestellt hat.
Darum waren fraglos „Pflege und Erziehung“ der Kinder das „natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG).
Diesem Familienstatus sind weder der Gesetzgeber noch gar die Rechtsprechung gerecht geworden.
Heute wird ein solcher Familienbegriff kaum noch verstanden.[90]
Privat ist dabei kein Gegensatz zu öffentlich.
Auch als nichtstaatlicher Gewaltträger ist die Familie eine öffentliche Institution[91], nämlich eine wesentliche Ordnungsmacht des Gemeinwesens.
Privat ist der Gegensatz zum Staat.[92]
- [87] Zur Vielfalt der Gewaltenteilung SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Prinzipien des Rechtsstaats, Duncker & Humblot, Berlin 2006, S. 167 ff.
- [88] BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, 103, 124, 131; vgl. auch STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 68 f.; tendenziell richtig LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 6 ff., 59 ff. („Ehe und Familie Grundlage eines sittlichen Staates“); SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 160
- [89] Zur familiären, vertragstheoretischen Vereinzelungstendenz der Spätaufklärung, zurückgedrängt durch die Romantik SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 280 ff., 284 ff.
- [90] Vgl. etwa GRÖSCHNER, R.: Art. 6, Rdn. 9 f., 67 ff.; ZACHER, H.F.: Elternrecht, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI, Müller, Heidelberg 1989, § 134, Rdn. 1; MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 13 ff.; gegen „Überindividualität“ der Familie auch ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 573; richtig aber OSSENBÜHL, F.: Das elterliche Erziehungsrecht im Sinne des Grundgesetzes, Duncker & Humblot, Berlin 1981, S. 53 ff., 68 ff.; SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 160
- [91] Zur Familie als politischer Größe SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 295 ff.
- [92] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Der Anspruch auf materiale Privatisierung. Exemplifiziert am Beispiel des staatlichen und kommunalen Vermessungswesens in Bayern, Duncker & Humblot, Berlin 2005, S. 40 ff.; ders.: Freiheit in der Republik, S. 449 ff.
Seite 32
Das Leben der Familie ist entgegen der wesensmäßigen Privatheit derselben weitestgehend verstaatlicht.
Staatlichkeit besteht darin, dass die Handlungsmaximen gesetzlich bestimmt sind, auch wenn sie von privaten Personen vollzogen werden.[93]
Die Staatlichkeit des Familienlebens erweist sich im Recht der elterlichen Sorge.
Nach Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG wacht die staatliche Gemeinschaft über die Pflege und die Erziehung der Kinder.
Für dieses „Wächteramt“[94] bedarf er eines Maßstabes, nach dem auch die Eltern die Pflege und die Erziehung ihrer Kinder auszurichten haben.
Diesen Maßstab bestimmt der Gesetzgeber durch Generalklauseln.[95]
Die wesentliche Regelung ist § 1626 Abs. 2 BGB.
Danach haben die Eltern bei der Pflege und Erziehung die „wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis der Kinder zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen“ (S. 1).
„Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.“ (S. 2)
Damit werden materiale Prinzipien, aber auch Verfahrensprinzipien verbindlich, die jedenfalls im Streitfall der Staat definiert.
§ 1631 Abs. 2 BGB gibt „den Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“
Das Modell antiautoritärer Erziehung ist somit ins Gesetz geschrieben.[96]
Hoffentlich geht es gut, mir bleiben Zweifel.
Der bestimmende Begriff der elterlichen Sorge ist der des „Wohles des Kindes“[97] in § 1626 Abs. 3 BGB, den schon deswegen der Staat durch seine Behörden und Gerichte materialisieren kann und muss, weil ihn § 1666 BGB verpflichtet, „das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen“ gegen
- [93] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Der Anspruch auf materiale Privatisierung, S. 40 ff. (43 ff.); ders.: Freiheit in der Republik, S. 449 ff.
- [94] BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, 149; ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 572; STEIGER, H.: VVDStRL 45 (1987), S. 64; SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 634 ff., S. 311 ff.; ZACHER, H.F.: HStR, § 134, Rdn. 93ff.; BVerfGE 56, 363 (382); 60, 79 (94)
- [95] SCHWAB, D.: Ausgeträumt, S. 160
- [96] Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhaltsrechts v. 02.11.2000 (BGBl. I, 1479); dazu SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 547 f., S. 272 f.
- [97] Vgl. Die Hinweise in Fn. 68
Seite 33
„die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten“ zu verteidigen.
Dafür hat das Familiengericht die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Das Wohl des Kindes kann man sehr unterschiedlich definieren und den Eltern weite oder auch nur enge Definitionsmöglichkeiten lassen.
Gäbe es nicht die Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, wäre die religiöse Erziehung der Kinder allemal gefährdet.
Bekanntlich werden trotz Art. 4 Abs. 1 GG nicht alle Weltanschauungen toleriert, manche auch nicht, obwohl sie sich als Religionen verstehen.[98]
Gewissermaßen ist es der Überlastung der Behörden und Gerichte zu danken, dass der Staat nicht stärker in die elterliche Sorge eingreift.
Vorerst versucht der Staat seinen Einfluss auf die Erziehung der Kinder dadurch zu erweitern, dass er, wie schon gesagt, die Kinder dem Elternhaus entzieht, sogar schon in frühester Kindheit, fraglos ein Verfassungsverstoß, jedenfalls eine Missachtung des Familienprinzips.
Das staatliche Schulwesen, das mehr und mehr verfassungsrechtliche Bedenken auslöst[99], aber eine wenn auch schmale verfassungsgesetzliche Grundlage in Art. 7 Abs. 1 GG hat[100], obwohl dem Wortlaut nach lediglich ein Aufsichtsrecht des Staates über das Schulwesen formuliert ist, trägt wesentlich zur Verstaatlichung der Erziehung bei.
Nach der Rechtsprechung sollen Eltern und Schule einen gleichgeordneten Erziehungsauftrag haben.[101]
Schulen, in denen die Kinder um Leben und Gesundheit fürchten müssen, jedenfalls fast nichts lernen, sind allemal eine Verletzung des Wohls des
- [98] Zu den Jugendsekten BVerfGE 105, 279 (292 ff.); CAMPENHAUSEN, A. Frh. v.: Religionsfreiheit, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VI, Müller, Heidelberg 1989, § 136, Rdn. 73
- [99] LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 116 (jedenfalls eine verpflichtende Ganztagsschule)
- [100] Vgl. BVerfGE 34, 165 (181 f.); 47, 46 (71 f.); 52, 223 (236); ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 568 ff.; ZACHER, H.F.: HStR, § 134, Rdn. 86 f.
- [101] BayVerfGH 29, 191 (208); 33, 33 (43); 35, 90 (96); BVerfGE 47, 46 (72); ZACHER, H.F.: HStR, § 134, Rdn. 86
Seite 34
Kindes und der Pflicht des Staates, die Kinder zu erziehen und zu schützen[102], wenn er die Erziehung den Eltern schon aus der Hand genommen hat.
Der Staat bestimmt auch durch Gesetz und Gericht, wer überhaupt die elterliche Sorge hat, das sind nicht ohne weiteres die Eltern, obwohl nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG es das natürliche Recht eben der Eltern ist, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen, sondern es sind zunächst nur die verheirateten Eltern.
Immerhin hat § 1626a BGB, einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgend[103], auch die gemeinsame elterliche Sorge der nicht miteinander verheirateten Eltern ermöglicht, wenn diese erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen oder einander heiraten.
Die Erklärung muss freilich von beiden Elternteilen selbst und öffentlich beurkundet abgegeben werden (§§ 1626e und d BGB).
Die Mutter hat es also in der Hand, dem Vater die elterliche Sorge zu verwehren; denn ohne die Sorgeerklärung beider Eltern hat nach § 1626a Abs. 2 BGB die Mutter die elterliche Sorge.
Die biologische Vaterschaft, auf die es wohl ankommen sollte und die das Grundgesetz als Normalfall gesehen haben dürfte, wird schlicht übergangen, wiederum ein Problem, das sich überhaupt erst aus dem Verfall der Familien ergeben hat.
Geradezu symbolisch für das Ende von Ehe und Familie als Einheit ist das Namensrecht.
Nach Jahrhunderten, in denen in Deutschland der Name des Mannes der Familienname wurde[104], ist das Prinzip des einheitlichen Ehenamens aufgegeben (§ 1355 Abs. 1 S. 3 BGB; die Kindernamen regeln §§ 1616 f. BGB).
Jeder Ehegatte kann seinen Namen fortführen.
Die eheliche und familiäre Einheit muss in der Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar sein.
Die Familie sind nur noch
- [102] ZEIDLER, W.: HVerfR, S. 573 f.
- [103] BVerfGE 84, 168 (179 ff.); vgl. auch BVerfGE 92, 158 (179); 107, 150 (168 ff.); SCHWAB, D.: Familienrecht, Rdn. 682 f., S. 332 f.; dazu MÜNCH, E. M. v.: HVerfR, § 9, Rdn. 28
- [104] Vgl. BOEHMER, G.: Einführung in das Bürgerliche Recht, 131 („alte deutsche Volkssitte“); LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 79
Seite 35
private Rechtsbeziehungen, nicht mehr die öffentliche Korporation mit dem Familiennamen, gewissermaßen als Firma.
Die Innenverhältnisse der Familie eignen sich nicht für die gesetzliche Ordnung.[105]
Fraglos muss jedes Familienmitglied als ein Mensch in seinen Grundrechten vom Staat geschützt werden, in seiner Würde, in seinem Leben, in seiner Gesundheit usw.[106]
Die Schutzpflicht des Staates kann nicht vor der Familie halt machen müssen, aber es fragt sich, ob der Staat weiter in die Familie eindringen können soll, als es zur Abwehr von Straftaten notwendig ist.
Auch der Intimbereich der Familie, der nach Praxis des Bundesverfassungsgerichts unantastbar sein soll[107], wird immer kleiner, zumal der Staat mehr und mehr dazu übergeht, alles wissen zu wollen, was der Mensch sagt und schreibt.
Dafür hat er die nötigen Geräte.[108]
Wer sich in der Familie auf Gesetze beruft, stört den Familienfrieden.
Es ist geradezu eine sittliche Haltung, wenn ein junger Mann seinen Vater, der sich von der Familie getrennt hat, nicht auf Unterhalt verklagt, obwohl der Vater seine Unterhaltspflichten nicht erfüllt.
Es zeigt sich der Respekt des Sohnes vor dem Vater und sein Gefühl für die Familie.
Eine noch größere sittliche Leistung ist es, wenn die Mutter, die für den Sohn alleine sorgen muss, ihn nicht drängt, den Vater zu verklagen.
Das ist familiäre Sittlichkeit.
Der Staat hat als Familiengesetzgeber versagt.
Zur Zeit kann man nur empfehlen, dass der Staat sich aus der Ehe- und Familienpolitik heraushält, damit die
- [105] SCHWAB, D.: Geschichtliche Grundbegriffe, S. 284 ff. (zur Romantik), S. 293
- [106] Zu den Gesetzgebungs-, insb. den Schutzpflichten BVerfGE 39, 1 (41 ff.); 49, 89 (140 ff.); 53, 30 (57 ff., 65 ff.); 56, 54 (73 ff., 78 ff.); 84, 212 (227); 88, 203 (251 ff.); 99, 145 (156 ff.); SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Res publica res populi, S. 545 ff., 819 ff.; ders.; Umweltschutz, Fallstudien zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht, Nürnberg 2003, S. 303 ff.; ders.: Freiheit in der Republik, S. 312, 358, 370, 512; ISENSEE, J.: Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, HStR, Bd. V, Müller, Heidelberg 1992, § 111, Rdn. 1 ff., 77 ff.
- [107] Vgl. BVerfGE 6, 389 (433 ff.); 27, 1 (7 f.); st. Rspr.; BVerfGE 96, 56 (61); 101, 361 (379 ff., 385); D. ROHLF, Der grundrechtliche Schutz der Privatsphäre. Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Art. 2 Abs. 1 GG, Duncker & Humblot, Berlin 1980, S. 76 ff.; SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 623 ff.
- [108] Einschränkend zur Online-Überwachung BVerfG, Urteil des Ersten Senats v. 27.02.2008 1 BvR 370/07 / - 1 BvR 595/07; zum Lauschangriff BVerfGE 109, 279 (308 ff.)
Seite 36
Gesellschaft die Chance hat, ohne staatliche Fehlsteuerung zu Ehen und Familien (zurück)zufinden, deren menschheitlicher Wert sich für alle Altersgruppen, vor allem auch für die Kinder und für die alten Menschen wieder bewähren kann.
Der Staat hat weitgehend die Familienfunktionen übernommen, vor allem die Vorsorge für die Nöte des Lebens, aber die staatlichen Prinzipien können der Ehe und der Familie nicht gerecht werden.
Die staatliche Vorsorge hat Wert und Prinzip von Ehe und Familie erdrückt, deren Notwendigkeit wesentlich gemindert.
Sie fördert die Vereinzelung der Menschen und zugleich deren Degradierung zu Humankapital, ausbeutbar als Arbeitnehmer und Verbraucher.
Der vereinzelte, unbehauste Mensch lebt im Staat, schlimmer noch in weltweit integrierten, ökonomistischen Herrschaftssystemen, nicht aber existentiell geborgen in der Familie.
Die deutsche Familie muss wie Familien anderer Völker in einem gewissen Maße wieder einen eigenständigen, körperschaftlichen, ordnungsbefugten Status zurückgewinnen, in größerem Maße als gegenwärtig für den Staat impermeabel werden.
Nur das entspricht dem Privatheitsprinzip, das der privaten den Vorrang vor der staatlichen Lebensbewältigung zumisst.[109]
Dieses Privatheitsprinzip findet in der Formulierung des Art. 6 Abs. 1 GG Ausdruck; denn es heißt: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“, nicht: Der Staat regelt die Ehe- und Familienverhältnisse.
Nicht der Staat schafft durch seine Gesetze Ehen und Familien.
Er findet diese vielmehr als Seiensweise der Menschen vor und hat diese zu schützen, wohlgemerkt, die Familien als Ordnungsmacht mit nichtstaatlicher familiarer Gewalt.
Familie sind nicht nur besondere Beziehungen verbundener Menschen.
Vielmehr muss Familie Eigenstand haben, mit Hegel in gewisser Weise Person sein, familiare (sittliche) Person mit Familienmitgliedern.
Dieses Postulat empfiehlt kein Zurück zu antiken
- [109] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Der Anspruch auf materiale Privatisierung, S. 67 ff.; ders.: Freiheit in der Republik, S. 465 ff.
Seite 37
Verhältnissen, aber zu einem rechten Maß von Privatheit und Staatlichkeit des Familienlebens.
 V. Ordnung durch Verträge
V. Ordnung durch Verträge
Ein Staat, der gezeigt hat, dass er Ehe und Familie nicht zu schützen vermag, ist nicht befähigt, den Familien die Gesetze zu geben.[110]
Es ist zu erwarten, jedenfalls zu hoffen, dass die Menschen es besser bewältigen, dem Familienprinzip gerecht zu werden.
Dafür haben sie den Vertrag, das alte Werkzeug der Rechtsetzung und des friedlichen Miteinanders der Menschen.[111]
Durch Vertrag können die Menschen in freiheitlicher Privatheit ihre Verhältnisse ordnen.
Verträge könnten die Lebenszeitigkeit der Ehe wieder verbindlich machen, jedenfalls die Scheidung auf eine wirkliche Unzumutbarkeit einschränken.
Sie könnten ermöglichen, dass Ehen und Familien wieder christlich gelebt werden.
Auch das Unterhaltsrecht und Vermögensrecht könnte nach dem Willen der Vertragspartner gestaltet werden.
Verträge werden dem Privatheitsprinzip gerecht.[112]
Der Staat darf sich keine Ordnungsmacht anmaßen, wenn die Gesellschaft die Ordnung allein herstellen kann, zumal diese Ordnungsmacht sogar grundrechtsgeschützt ist.
Erst recht darf der Staat die Lebensverhältnisse nicht seinen Ordnungsvorstellungen unterwerfen, wenn er kein tragfähiges Ordnungsmodell hat, sondern seine Regelungen erkennbar schaden, wie es die zunehmende Zerstörung der Familie als grundlegende Einrichtung des Gemeinwesens erweist.
Eine verbindliche Ordnung der Ehe und auch Familie für alle wäre gut, wenn wir ein verfassungsgemäßes Ordnungskonzept hätten.
Der Staat hat sich angemaßt, Ehe- und Familienrecht für alle zu geben, aber die Pluralität, genauer: die Heterogenität der Gesellschaft missachtet.
Als allgemeiner Gesetzgeber versagt er in diesen
- [110] I.d.S. HÖSLE, V.: Moral und Politik, S. 850 f.; LECHELER, H.: HStR, § 133, Rdn. 9 („Agonie“)
- [111] HÖSLE, V.: Moral und Politik, S. 852, der auf Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, in: Gesammelte Schriften, Erste Abt.: Werke, hrsg. v. A. Leitzmann, Bd. I, Berlin 1903 (97-254), S. 122, verweist.
- [112] SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Freiheit in der Republik, S. 513 ff.
Seite 38
Verhältnissen geradezu unvermeidlich.
Die Entstaatlichung der Lebensverhältnisse gibt eine Chance, die existentielle Bedeutung der Familie für das Leben der Menschen zurückzugewinnen und damit die individualistische Entwürdigung des Lebens zu überwinden.
Der fürsorgende Wohlfahrtsstaat ist zugleich eine bevormundende Despotie, unfähig die Grundlagen des Gemeinwesens, nämlich Ehe und Familie, zu hegen und zu pflegen.
Das individualistische Gleichheitsprinzip zerstört das Gemeinwesen, das ausweislich der Menschenrechtserklärung der Ehen und Familien bedarf.
Das Vertragsprinzip würde ein anderes politisches Verfahren der Ordnung der Familien an die Stelle des Gesetzesprinzips setzen, das Prinzip, das die meisten Lebenslagen zu ordnen sich bewährt hat, etwa das Arbeitsleben, das Wirtschaftsleben und weitgehend das Wohnen.
Es ist nicht hinzunehmen, dass der Staat der Parteien, der nach aller Erfahrung eine Negativauslese der Politiker mit sich bringt[113], auch in den Familien herrscht, auch deswegen nicht, weil ein solcher Staat nicht das Wohl der Menschen verfolgt, sondern das Parteienwohl und die Interessen der Parteigänger.
Mit Familien, deren Autonomie gestärkt ist, wäre eine bessere Zukunft unseres Landes zu erwarten.
Es versteht sich, dass in solchen Familien nicht wieder eine alleinige väterliche Gewalt eingerichtet werden darf, sondern die Gleichberechtigung von Mann und Frau bestimmendes Prinzip sein muss.
Allerdings muss auch die feministische Umwandlung der Lebensverhältnisse nicht fortgesetzt werden.
Die Entwicklung kann man den Verträgen überlassen, die oft von religiösen Überzeugungen bestimmt sein werden und bestimmt sein dürfen.
Vielfalt und Unterschiedlichkeit geben allemal mehr Chance für die Familie als die familiäre Not, die der Parteiengesetzgeber geschaffen hat.
- [113] MICHELS, R.: Zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie, Klinkhardt, Leipzig 1911, S. 439; WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, ed. Johannes Winckelmann, 5. Aufl., Tübingen 1972, S. 838 ff.; JASPERS, K.: Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, 1965, 10. Aufl., Piper, München 1988; WASSERMANN, R.: Die Zuschauerdemokratie, Piper, München 1986/1989, S. 112 ff.; SCHACHTSCHNEIDER, K.A.: Res publica res populi, S. 1064 ff., 1115; ders.: Prinzipien des Rechtsstaats, S. 312, 317
Seite 39
 Literaturverzeichnis:
Literaturverzeichnis:
- BOEHMER, Gustav: Einführung in das Bürgerliche Recht, 2. Aufl., Tübingen 1965 (Mohr)
- BRUDERMÜLLER, Gerd: Einführung vor § 1353, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 64. Aufl., München 2005 (Beck)
- BRUNNER, Otto: Das „Ganze Haus“ und die alteuropäische „Ökonomik“, in: ders. (Hrsg.), Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. 2. Aufl., Göttingen 1968 Vandenhoeck & Ruprecht, S. 193 ff.
- BRUNNER, Otto: Vom „gesamten Haus“ zur Familie, in: H. ROSENBAUM (Hrsg.), Familie und Gesellschaftsstruktur, Frankfurt 1974 (Fischer), S. 48 ff.
- CAMPENHAUSEN, Axel Frh. v.: Religionsfreiheit, in: J. ISENSEE/P. KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, Freiheitsrechte, Heidelberg 1989 (Müller), § 136, S. 369 ff.
- CAMPENHAUSEN, Axel Frh. v.: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, VVDStRL 45 (1987), Berlin 1987 (De Gruyter), S. 8 ff.
- DIEDERICHSEN, Uwe: Kommentierung der § 43 und 48 EheG, in: Palandt,, Bürgerliches Gesetzbuch, 34. Aufl., München, 1975 (Beck)
- DIEDERICHSEN, Uwe: Einführung vor § 1564, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 42. Aufl., München, 1983 (Beck)
- ELERT, Werner: Das christliche Ethos. Grundlinie der lutherischen Ethik, 2. Aufl., hrsg. v. E. KINDER, Hamburg, 1961 (Furche)
- GRÖSCHNER, Rolf: Kommentierung von Art. 6 GG, in: DREIER, H. (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, Artikel 1 – 19, 2. Aufl., Tübingen 2004 (Mohr)
- GÜNTHER, Horst: Herrschaft, in: O. BRUNNER/W. CONZE/R. KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982 (Klett-Cotta), S. 39 ff.
- HEFERMEHL, Wolfgang: Kommentierung von § 138, in: H. SOERGEL/ W.
- SIEBERT, Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 1, Allgemeiner Teil, Stuttgart u.a., 1978 (Kohlhammer)
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrissen, 1821, Frankfurt am Main 1968 (Fischer Bücherei)
- HENKE, Wilhelm: Recht und Staat. Grundlagen der Jurisprudenz, Tübingen 1988 (Mohr)
- HÖSLE, Vittorio: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert, München 1997 (Beck)
- ISENSEE, Josef: Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, Allgemeine Grundrechtslehren, Heidelberg 1992 (Müller), § 111, S. 143 ff.
- JASPERS, Karl: Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, 1965, 10. Aufl., München 1988 (Piper)
Seite 40
- KANT, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785/1786, ed. Weischedel, Bd. 6, Darmstadt 1968 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), S. 41 ff.
- KANT, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, 1788, ed. Weischedel, Bd. 6, Darmstadt 1968 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) S. 140 ff.
- KANT, Immanuel: Metaphysik der Sitten, 1797/1798, ed. Weischedel, Bd. 7, Darmstadt 1968 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), S. 345 ff.
- LECHELER, Helmut: Schutz von Ehe und Familie, in: J. ISENSEE/P. KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, Freiheitsrechte, Heidelberg 1989 (Müller), § 133, S. 211 ff.
- LECHELER, Helmut: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, DVBl. 1986, 905 ff.
- LINDACHER, Walter: Anmerkung zu EG Emden, JR 1976, 60 f.
- MANGOLDT, Hermann v./KLEIN, Friedrich: Kommentierung von Art. 6 GG, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Berlin/Frankfurt 1955/57 (Vahlen)
- MEIER, Christian: Macht, Gewalt, in: O. BRUNNER/W. CONZE/R. KOSELLECK, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982 (Klett-Cotta), S. 820 f.
- MICHELS, Robert: Zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie, Leipzig 1911 (Klinkhardt)
- MÜNCH, Eva Maria v.: Ehe und Familie, in: E. BENDA/W. MAIHOFER/H. J.
- VOGEL (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl., Berlin 1994 (De Gruyter), § 9, S. 293 ff.
- OSSENBÜHL; Fritz: Das elterliche Erziehungsrecht im Sinne des Grundgesetzes, Berlin 1981 (Duncker & Humblot)
- RIEDEL, Manfred: Begriff der „Bürgerlichen Gesellschaft“ und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs, 1962/1969, in: E.-W. Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, Frankfurt 1976 (Suhrkamp), S. 87 ff.
- ROHLF, Dietwalt: Der grundrechtliche Schutz der Privatsphäre. Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Art. 2 Abs. 1 GG, Berlin 1980 (Duncker & Humblot)
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, Aussprache, VVDStRL 45 (1987), Berlin 1987 (De Gruyter), S. 136 f.
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Res publica res populi. Grundlegung einer Allgemeinen Republiklehre. Ein Beitrag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, Berlin 1994 (Duncker & Humblot)
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Der Anspruch auf materiale Privatisierung. Exemplifiziert am Beispiel des staatlichen und kommunalen Vermessungswesens in Bayern, Berlin 2005 (Duncker & Humblot)
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Der republikanische Parteienstaat, 2000, in: ders., Freiheit – Recht – Staat, hrsg. v. SIEBOLD, D. I./EMMERICHFRITSCHE, A., Berlin 2005 (Duncker & Humblot), S. 213 ff.
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Prinzipien des Rechtsstaats, Berlin 2006 (Duncker & Humblot)
Seite 41
- SCHACHTSCHNEIDER, Karl Albrecht: Freiheit in der Republik, Berlin 2007 (Duncker & Humblot)
- SCHÖNKE, Adolf/SCHRÖDER, Horst: Strafgesetzbuch, Kommentar, 15. Aufl., München 1970 (Beck)
- SCHWAB, Dieter: Familie, Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. O. BRUNNER/W.
- CONZE/R. KOSELLECK, Bd. 2, E-G, Klett-Cotta, Stuttgart, 1975, S. 253 ff.
- SCHWAB, Dieter: Familienrecht, 15. Aufl., München 2007 (Beck)
- SCHWAB, Dieter: Ausgeträumt, in: Glanzlichter der Wissenschaft. Ein Almanach, hrsg. v. Deutschen Hochschulverband, Stuttgart 2007 (Lucius & Lucius), S. 155 f.
- SCHWARZ, Otto/DREHER, Eduard: Strafgesetzbuch, Kommentar, 25. Aufl., München 1963 (Beck)
- STEIGER, Heinhard: Verfassungsgarantie und sozialer Wandel – Das Beispiel von Ehe und Familie, Aussprache, VVDStRL 45 (1987), Berlin 1987 (De Gruyter), S. 61 ff.
- STERNBERGER, Dolf: Der alte Streit um den Ursprung der Herrschaft, 1977, in: ders., Herrschaft und Vereinbarung, Schriften Bd. III, Frankfurt 1980 (Suhrkamp)
- STERNBERGER, Dolf: Herrschaft und Vereinbarung, Frankfurt 1986 (Suhrkamp)
- WASSERMANN, Rudolf: Die Zuschauerdemokratie, München 1986/1989 (Piper)
- WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5. Aufl., Tübingen 1972 (ed. Johannes Winckelmann)
- WIERUSZOWSKI, Alfred: Art. 119, Ehe, Familie, Mutterschaft, in: NIPPERDEY, H.C. (Hrsg.) Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, 2. Bd., Berlin 1930 (Hobbing), S. 72 ff.
- WOLFF, Martin: Familienrecht, Marburg, 6. Bearbeitung 1928 (Elwert)
- ZACHER, Hans F.: Elternrecht, in: J. ISENSEE/P. KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, Freiheitsrechte, Heidelberg 1989 (Müller), § 134, S. 265 ff.
- ZEIDLER, Wolfgang: Ehe und Familie, in: E. BENDA/W. MAIHOFER/H. J.
- VOGEL (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, Berlin 1983 (De Gruyter), S. 555 ff.
- Quelle:
- http://www.kaschachtschneider.de/wp-content/uploads/2017/10/Rechtsproblem_Familie.pdf
 Siehe auch
Siehe auch
|