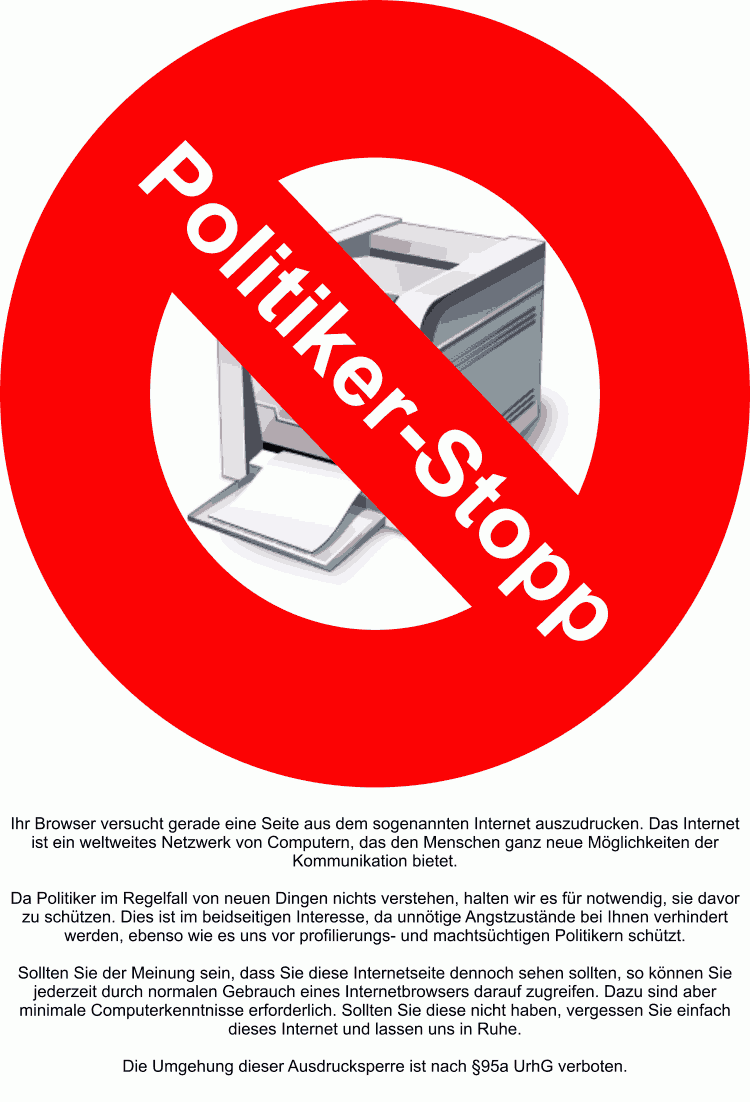Beachten Sie unseren neuen Webauftritt: de.dfuiz.net Die Familie und ihre Zerstörer Eine überfällige gesellschaftliche Debatte Was schief läuft und was anders werden muss |
| |||||
Die demographische Frage wird drängender. Deutschland und viele andere westliche Staaten überaltern. Höhere Lebenserwartung und ein dramatischer Geburtenrückgang führen zu einer Erosion unserer gesellschaftlichen und sozialpolitischen Grundlagen. Seit etwa 25 Jahren liegt das Geburtenniveau um etwa ein Drittel unter dem Stand, der für den sogenannten Generationenersatz erforderlich ist. Für die Sozialversicherungssysteme öffnet sich die Schere zwischen der Anzahl leistungsfähiger Beitragszahler und derjenigen der Leistungsempfänger immer mehr. Das Umlageverfahren der Rentenversicherung stößt deutlich an seine Grenzen. Leistungssenkung und Beitragserhöhung werden zu einer tagtäglichen Vermittlungsleistung der Politik. Ein guter Teil der innenpolitischen Debatten ist schon längst nur noch Reaktion auf die demographische Schieflage. Arbeitskräftemangel, Einwanderung, Bildungsmisere, Steuer- und Sozialpolitik – ohne den Problemdruck der rasch überalternden Bevölkerung hätten alle diese Diskussionen ein ganz anderes Gesicht. Die Quelle dieser Probleme ist eindeutig zu bestimmen. Die Zahl der Geburten ist alarmierend niedrig, unser individueller Lebensstil scheint fehlprogrammiert. Kinder gelten überwiegend als Last, sie werfen die Eltern im Wohlstandswettlauf weit zurück, machen es schwer, die bunten Angebote einer Freizeit- und Selbstverwirklichungsgesellschaft auszukosten. Die Kraft kinderfreundlicher Leitbilder dagegen ist erlahmt. Kinder gelten weder als Segen Gottes noch als Quelle von emotionalem Reichtum, von schlichter Freude oder gar tieferem Lebenssinn. Verfassungsrechtlicher Schutz für soziale Institutionen Dieser klare Befund ist unangenehm. Unsere Reaktionen auf diesen Befund schwanken zwischen Verdrängung und symbolischen Debatten. Die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung ignoriert die Tiefe des demographischen Problems, so gut es geht und solange es geht. Man kann dabei Fatalismus zeigen, das Problem einer aussterbenden Gesellschaft auch offensiv tabuisieren oder wegerklären, vage auf Zuwanderung aus anderen Kulturen hoffen, man kann ablenken oder mit schönen Gesten das Publikum beruhigen. Das Problem wird so allerdings nicht gelöst. Irgendwann könnte daher das Pendel in die andere Richtung ausschlagen, in die der dramatischen Alarmierung, der Überreaktion. Vom Staat und von seinen Bürgern würden dann womöglich energische Anstrengungen verlangt. Wer hielte noch fest an alten Freiheitsversprechen, wenn die Gesellschaft am demographischen Abgrund stünde? Die Verfassung weist einen klügeren Mittelweg. Das Grundgesetz hat sehr weitsichtig das Freiheits- und das Gemeinschaftsprinzip miteinander verbunden. Gerade der Artikel 6 muß als Grundrecht gelesen werden, das die existentiellen Belange kleinster wie großer Gemeinschaften untereinander und mit dem Freiheitsprinzip zum Ausgleich bringt. Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes stellt Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung: ein bemerkenswerter Verfassungssatz. In einem negativen Sinne ist es dem Staat untersagt, Ehe und Familie zu schädigen oder sonst zu beeinträchtigen; in einem positiven Sinne geht es um die Aufgabe des Staates, Ehe und Familie nicht nur vor Beeinträchtigungen Dritter, also durch gesellschaftliche Kräfte, zu bewahren, sondern soweit erforderlich auch durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Die Verfassung trifft eine objektive Wertentscheidung für die Ehe und die Familie; sie verkörpern wertvolle Gemeinschaften, auf die der freiheitliche Staat nicht verzichten kann. Beide Formen des Zusammenlebens werden eigenständig oder idealtypisch sich überschneidend als soziale Institution geschützt. Ihre Funktionsbelange und ihre kulturelle Substanz sind bei jeder Ausübung öffentlicher Gewalt zu achten, die Gesetzgebung hat ihren Wertgehalt positiv zu verwirklichen. Mit Institutsgarantien wie der des Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes gewährleistet die Verfassung bewußt den Fortbestand altbewährter, vom Rechtsbewußtsein des Volkes getragener Einrichtungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Etwas allgemeiner könnte man sagen: Institutionen sind im Alltag geprägte, feststehende, für die politische Gemeinschaft als wertvoll erkannte soziale Verhaltensmuster, die auf einer hergebrachten identitätsstiftenden Idee beruhen und die mit Geboten von Sitte und Moral oder solchen des Rechts stabil gehalten und gegenüber Abweichungen behauptet werden. Institutsgarantien darf der Gesetzgeber zwar ausgestalten – und in gewissem Umfang muß er dies tun –, er darf sie aber weder abschaffen noch ihren Kernbereich verletzen, er darf auch nicht die bestimmenden Merkmale des Bildes von Ehe und Familie, das der Verfassung zugrunde liegt, mittelbar beeinträchtigen. Dabei ist institutioneller Schutz auch immer Schutz vor Nivellierung im Vergleich zu anderen Lebens- und Sozialformen; die Institution wird in ihrer Besonderheit, das heißt auch in ihrem Anderssein, hervorgehoben und geschützt, gegen gesetzliche Einebnung steht deshalb ein Differenzierungsgebot. Die Vorstellung indes, daß hergebrachte kulturelle Einsichten und gesellschaftliche Funktionserfahrungen dem heutigen Gesetzgeber eine Grenze setzen sollen, ist dem egalitären Denken schwer zu vermitteln. Genau dies ist aber vom besonderen Institutsschutz in seiner defensiven Ausrichtung gefordert. Wer strikt progressiv denkt, den werden Einrichtungsgarantien wie Artikel 6 des Grundgesetzes mit ihrem Beharrungsvermögen ohnehin stören, und er wird dazu neigen, sie für überflüssig zu erklären. Aber man sollte nicht allzu eilig Einrichtungsgarantien verabschieden: Sie sind ein von der Verfassung gewolltes kulturelles Gedächtnis in schnellebiger Zeit; sie mäßigen den gesellschaftsverändernden Gesetzgeber um der Freiheit erprobter Lebensformen willen; sie sind geltendes Verfassungsrecht. Was ist der Kerngehalt des verfassungsrechtlichen Schutzes von Ehe und Familie? Wenn das Leitbild von Ehe und Familie zumindest bei tonangebenden Eliten erst in Fluß und dann in Streit gerät, wenn das sozial konstruierte überlieferte Bild seine Entsprechung in der Wirklichkeit, seinen Wiedererkennungswert teilweise verliert, so muß die Verfassungsinterpretation zurückgehen und nach dem grundlegenden Sinngehalt einer objektiven Wertentscheidung fragen, um von dort aus eine Verfassungsnorm neu bestimmen zu können, um aufzuschließen zu geänderten Lebensverhältnissen, ohne die verbindlich gemachte Wertentscheidung preiszugeben. Artikel 6 des Grundgesetzes ist ein Fundamentalgrundrecht gesellschaftlicher Integration, und zwar auf der ersten, alles andere tragenden Stufe. Es stellt einen Systemzusammenhang her zwischen individuellem Freiheitsanspruch, dem Schutz einer Gruppe und dem Bestandswillen einer politischen und sozialen Gemeinschaft. Die Begriffe des Artikels 6 betreffen elementare Voraussetzungen jeder Gemeinschaftsbildung, sie betreffen und umzirkeln das Wohl der Kinder auch und gerade als die Zukunft der staatlichen Gemeinschaft. In Artikel 120 der Weimarer Reichsverfassung, die dem heutigen Artikel 6 des Grundgesetzes ein Vorbild gab, hieß es: „Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern, über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht.„“ Es geht bei der Institutsgarantie um nichts weniger als eine Wertentscheidung der Verfassung über die tatsächlichen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland. Damit auch in Zukunft freie Menschen sich in Solidarität beistehen und die Werte des Grundgesetzes bejahen, damit aus Kindern selbstbewußte und moralisch kompetente Bürger werden, braucht es die Lebensgemeinschaft der Ehe, da sie die konzeptionell und tatsächlich geordnete Grundlage für ihre Erweiterung zu der mit Kindern bereicherten Familie ist. Die Ehe ist ein Spezialfall der Familie, die typische Form der rechtlich anerkannten ursprünglichen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Ihrer ideellen Ausrichtung auf die mit Kindern gesegnete Familie zum Trotz ist die Ehe schon bereits für sich, das heißt auch im Falle der Kinderlosigkeit geschützt. Die kinderlose Ehe ist keine Ehe zweiter Klasse. Die traditionelle Form des Zusammenlebens in Familien, die durch Ehe gestiftet und mit Kindern bereichert sind, entspricht dem Kernanliegen des Artikels 6. Diese historisch überlieferte, durch heute kaum noch nachvollziehbare Krisen und Herausforderungen erprobte Gemeinschaft hat Anspruch auf besondere Schutzmaßnahmen des Staates, ideeller und materieller Art. In den klassisch bürgerlich formulierten Sinngehalten der Familie ist das kulturelle Gedächtnis vieler Generationen und großer Traditionen gespeichert. In den christlich überlieferten Menschenbildern – der Würde des einzelnen, der Intimität der Ehe, der Geborgenheit familialer Lebensgemeinschaften, der Sorge um die Kinder – ist ein ursprüngliches Humanitätsprogramm angelegt, von dessen Tiefenbedeutung bis heute ausnahmslos unsere Chance auf Freiheit und auch jeder emanzipatorische Akt der Gleichstellung lebt. Der Familienbegriff des Artikels 6 ist aber nicht allein an die Ehe gebunden, schon weil es dem Grundgesetz auch außerhalb des Regeltypus der Ehe um die Sicherung würdiger Lebensgemeinschaften für Kinder und mit Kindern geht. Dies wird besonders deutlich durch die Absätze 4 und 5 des Artikels, insofern es dort um die Gemeinschaft von Mutter und Kind und die Rechtsstellung des unehelichen Kindes geht. Familie in einem weiteren Sinne ist deshalb auch die Lebensgemeinschaft von Erwachsenen mit Kindern, also ein geeigneter sozialer Ort, an dem Kinder behütet wachsen und reifen können. Es geht in der Grundentscheidung um die Sicherung des gemeinschaftlichen Lebensraums für Kinder, für die nachwachsende Generation. Als Lebens- und Entfaltungsraum für die Einheit von Erwachsenen und Kindern ist Familie ein Refugium gesellschaftlicher Freiheit, abgeschirmt von der Macht der Kollektive, dabei selbst eine ursprüngliche, erste und sozial unabgeleitete Gemeinschaft. Den gleichwohl bestehenden Trend zu weiterer Individualisierung der Lebensverhältnisse hat der freiheitliche Staat als Entscheidung seiner Bürger zu respektieren; es besteht aber keine Pflicht, ihn zu fördern, schon gar nicht zu Lasten bestehender Gemeinschaften. Artikel 6 verpflichtet vielmehr die öffentliche Gewalt, freiwillige Bindungen hin zu Ehe und Familiengründung zu ermöglichen und zu unterstützen, damit das Prinzip der Verantwortung immer wieder neue Wurzeln in der Wirklichkeit schlagen kann. Im Zentrum stehen die Kinder. Mit ihrem Schutz sichert das politische Gemeinwesen zugleich seine Existenz in der Zeit und seine kulturelle Identität. Die intakte Familie prägt wie keine zweite Instanz den freien Menschen als zur moralischen Einsicht fähigen Bürger. Erziehung aus der Gemeinschaft heraus ist die Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit: deshalb der klare Schutzauftrag an die staatlich organisierte Gemeinschaft. Je dichter das Netz der rechtlichen Erfassung der Familie wird und je weiter der Aufbau einer sozialpolitischen Infrastruktur der Kinderbetreuung reicht, desto mehr schrumpft der Raum für die staatlich unberührte familiäre Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von Ehe und Familie ist ein Teil der Privatsphäre, das heißt mit dem Recht bewehrt, alles Öffentliche dort auszuschließen. Der Ruf nach dem Staat führt zu einem Eindringen der öffentlichen Gewalt in diese privat abgeschirmte Sphäre, führt à la longue zu einer Vergesellschaftung der familialen Gemeinschaft. Ein solcher Trend läßt sich verfassungsrechtlich nur beurteilen, wenn Gemeinschaft und Gesellschaft sinnvoll auseinandergehalten werden. Der Soziologe Ferdinand Tönnies hat in seinem aus dem späten 19. Jahrhundert stammenden Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft„“ dieses Begriffspaar als analytische Grundkategorien entwickelt. Beide Sozialformen bringen Menschen miteinander in Kontakt, aber auf verschiedene Weise, entweder „organisch„“ (Gemeinschaft) oder „mechanisch„“ (Gesellschaft) – so der damalige Sprachgebrauch. In der Gemeinschaft entstehen und wachsen danach menschliche Beziehungen spontan und um ihrer selbst willen, zu denken ist an Familie, Nachbarschaft oder Freundschaft, aber auch an die Religionsgemeinschaft. Diese unmittelbaren Sozialbeziehungen sind geprägt durch das Gefühl von enger Zusammengehörigkeit und Solidarität. Ihr herrschendes Prinzip ist die Verbundenheit, auch wenn die in der Gemeinschaft lebenden Menschen zugleich als getrennte Individuen handeln und anerkannt werden. Diesen vitalen, gleichsam natürlichen Prozessen steht die auf individuellen Willensentscheidungen gegründete, volitiv organisierte Gesellschaft gegenüber. Deren Grundprinzip ist die Trennung, auch wenn punktuelle Verbundenheit über förmliche Beziehungen entsteht und gerade auch wenn die Menschen in der Gesellschaftsbeziehung friedlich „nebeneinander„“ leben. Mit den Worten von Tönnies bleiben die Menschen in Gemeinschaften trotz aller Trennungen wesentlich verbunden, während sie in der Gesellschaftsformation trotz aller Verbundenheiten wesentlich getrennt bleiben: ein scharfsinniges Beschreiben des modernen Individualismus. Die immer weiter vordringende „Gesellschaft„“ ist geprägt durch die Trennung von Zweck und Mittel, beruhend auf Kalkül und Rationalität und letztlich immer bezogen auf Interessen wie den Nutzen des Individuums. Hier herrscht der Einzelwille und bindet, hier wird der einzelne als Rechtssubjekt in formaler Gleichheit begriffen. Und hier schließlich paßt sich unser modernes Verständnis von Freiheit als dem einzelnen zugerechnete Entscheidung ein. Die Familie dagegen bleibt Gemeinschaft, für Tönnies „herzliche Verbundenheit und Einheit„“, ein gemeinschaftliches Leben, mit gegenseitigem Besitz und Genuß und gegenseitigem Beistand in der Not. Wenn die Rechtsordnung Gemeinschaften zu schützen hat, kann das in der Tendenz gegen die in individueller Verantwortung getroffene freie Entscheidung gerichtet sein, Unterhaltspflichten und Trennungsjahre sind Beispiele dafür. Gemeinschaftsprinzip und gesellschaftliches Freiheitsprinzip müssen dabei immer wieder in Einklang gebracht werden. Im Fall des Artikels 6 Absatz 1 des Grundgesetzes ist der Einfluß der Verfassung auf den Gesetzgeber beträchtlich, weil nicht nur die Institution geschützt wird, sondern ihre Verteidigung und – wo zu ihrem Schutz nötig – auch die Förderung durch die staatliche Rechtsordnung zu einer besonderen Pflicht gemacht wird. Die Verfassung will mit der Familie gerade eine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Möglichkeit der Freiheit unentbehrliche Einrichtung auch kontrafaktisch schützen, aber das Recht und der Staat wären wohl überfordert, wenn sie allein eine Einrichtung dauerhaft gegen den Willen oder doch die Gleichgültigkeit der Bürger verteidigen wollten. Es kam nach 1918 – durchaus folgerichtig – auch erst zu verfassungsrechtlichen Verbürgungen von Ehe und Familie, als ihr gesellschaftlicher Bestand durch Umwälzungen in der Gesellschaft erstmals in der Neuzeit wirklich bedroht war. Der zum Schutz von Ehe und Familie aufgerufene, dazu verpflichtete Staat gerät gerade heute leicht in ein sachliches und zeitliches Dilemma zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein Grundrecht, das zugleich eine gesellschaftliche Institution achten und fördern will, muß womöglich eine Wertentscheidung aus der Vergangenheit in einer partiell anders denkenden Gegenwart durchsetzen oder gar im Blick auf die Zukunft „umgestaltend„“ wirken, um die Idee in der Wirklichkeit zu bewahren. Damit wird sichtbar, daß mit dem verfassungsrechtlichen Schutz einer gesellschaftlichen Institution ein Stück weit eine einmal getroffene objektive Freiheitsentscheidung prolongiert wird oder, anders ausgedrückt, die Vergangenheit mit ihrem Freiheits- und Gemeinschaftsverständnis auf die Gegenwart freiheitsbeschränkend einwirkt. Die in ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten hinter kinderlosen Lebensformen zurückbleibende Familie ruft nach staatlicher Aufmerksamkeit und nach sozialpolitischer Zuwendung. Manche bringen es sogar auf den Punkt: Ohne Lastenausgleich und staatliche Rundumbetreuung für Kinder, beginnend mit dem sogenannten Krippenalter, weigern sie sich, Kinder überhaupt in die Welt zu setzen. Hier wäre es leicht, empört zu sein, von Erpressung des Staates zu reden, doch die Verhältnisse sind vielschichtiger. Artikel 6 des Grundgesetzes will den Fortbestand unserer politischen Gemeinschaft sichern, weitgehend unabhängig davon, welche kulturellen Auffassungen zu Kindern und Familienleben gerade vorherrschen oder sich in Zukunft bilden. Wenn eine größer werdende Zahl von Menschen für ein gelockertes Familienleben optiert und die Sorgepflicht gegenüber den Kindern mit der Berufstätigkeit beider Elternteile verbinden will, hat der Staat dies weder moralisch zu verurteilen noch zu glorifizieren, er hat insoweit schlicht Realitäten zu respektieren. Die objektive Wertentscheidung für den Schutz von Ehe und Familie begründet eine Förderpflicht, auch wenn man dem einzelnen nicht ohne weiteres daraufhin subjektive Ansprüche auf bestimmte Förderungsmaßnahmen zugestehen wird. Förderung kann in der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes nur in bestimmter Form erfolgen. Die individuelle Entscheidung für oder gegen Kinder ist als Ausdruck von Freiheit zu respektieren, aber diejenige für Kinder doch spürbar zu erleichtern. Der Staat muß den Familienzusammenhalt wirtschaftlich fördern, Familie prämieren, auch wenn insgesamt damit der „wirtschaftliche Wohlstandsabstand„“ zu Kinderlosen nur vermindert wird. Die staatliche Gemeinschaft ist offen für die Vielfalt der Lebensentwürfe; sie hat sie als Realität zur Kenntnis zu nehmen, aber sie sollte nicht ihrerseits sich ideologisch auf neue Lebensformen fixieren und sozialpolitisch experimentieren. Die individuelle Förderung und die kollektiven Leistungen der Gemeinschaft müssen sinnvoll und vor allem freiheitsgerecht kombiniert werden. Die dem Grunde nach zur Förderung geeignete Infrastruktur einer ganztägigen Kinderbetreuung darf nicht zum Zwangskorsett für diejenigen werden, die sich für eine engere Gemeinschaft mit ihren Kindern entscheiden. Die wirtschaftsliberale Gesellschaft darf auch darauf vertrauen, daß ernsthafte finanzielle Anreize für das Eingehen der Ehe und vor allem die Erziehung von Kindern eine positive Wirkung entfalten. Im Hinblick auf den Fortbestand der politischen Gemeinschaft kann das Grundgesetz schwerlich wertneutral interpretiert werden. Überspitzt: Die Verfassung optiert nicht für eine im Müßiggang aussterbende, sondern für die gedeihende, die Zukunft aktiv gestaltende, für die vitale Gemeinschaft. Diese in den demographischen Proportionen stimmige gesellschaftliche Vitalität ist eine Voraussetzung des freiheitlichen und solidarischen Verfassungsstaats. Deshalb ist eine Infrastruktur der Kinderfreundlichkeit grundsätzlich von der Verfassung gefordert. Die Befugnis, Familien besonders zu fördern, kann bei einer Veränderung der Lebensverhältnisse immer intensiver zu einer Pflicht werden. Weg vom konsumorientierten Individualismus Förderung wird zum gebotenen Schutz, wenn anders die Familie als tragende Institution der gesellschaftlichen Ordnung nicht mehr im notwendigen Umfang zu erhalten ist. Der Gesetzgeber verfügt dabei zwar über einen großen Gestaltungsspielraum – insbesondere Art und Maß der Förderung bestimmt er in seiner politischen Verantwortung –, aber der Spielraum verengt sich, wenn die demographische Entwicklung alarmierende Ausmaße annimmt oder ein Funktionsverlust familialer Integration nicht durch andere Sozialformen abgefangen werden kann. Von einer anderen Seite her wird der Gestaltungsspielraum aber immer auch durch das Freiheitsprinzip des Grundgesetzes begrenzt: Der Gesetzgeber hat auf die Vielfalt der Lebensstile Rücksicht zu nehmen. Er muß die traditionellen Formen des Familienlebens pflegen und zugleich neue Formen ermöglichen. Eine institutionelle Verfassungsvorschrift wie Artikel 6 des Grundgesetzes stellt allerdings eine Rangfolge her: Die altbewährten Formen sozialer Gemeinschaftsbildung genießen einen Vorrang vor dem Neuen, das erst noch zur gemeinschaftsbildenden Bewährung ansteht. So verstanden, zeigt das Grundgesetz einen Weg vorbei am demographischen Abgrund. Doch die Bürger müssen ihn gehen. Die westliche Welt hat ihre Ablehnung von Traditionen, ihren Individualismus und ihre Befreiungsthemen über Jahrzehnte gelebt, häufig auf Kosten tradierter Ordnungen – nun zeigen sich Risse im Fundament. Die große kritische Geste sollte sich heute auch gegen diejenigen Kritiker richten, die schon lange ihre verneinende Kraft aus den angeschlagenen sozialen Institutionen wie Ehe und Familie bezogen. Auf Dauer müssen wir wieder diejenigen Werte als Höchstwerte erkennen, die den Fortbestand einer jeden Gemeinschaft in Freiheit und Würde sichern. Es bedarf einer kulturellen Neuorientierung: Wir brauchen ein anderes Verhältnis zu Ehe, Familie und vor allem zu Kindern, als es das inzwischen eingeschliffene Muster konsumorientierten Individualismus geprägt hat. Wenn wir nicht noch gerade rechtzeitig begreifen, daß Kinder die entscheidende Zukunftsoption und vor allem eine Quelle erfüllten Lebens und wahrer Selbstverwirklichung sind, drohen wir als politische und soziale Gemeinschaft unsere Identität und Vitalität einzubüßen.
| ||